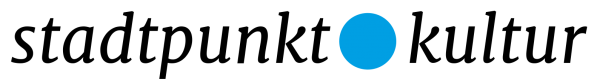Über Mindesthonorare in der Kunst
Es klingt nicht nur gut, es ist auch gut, dass sich bei der Frage der Mindesthonorare für Künstlerinnen und Künstler etwas tut. Öffentliche Förderung soll es nur noch geben, wenn bei der Umsetzung eines künstlerischen Projektes bestimmte Vergütungen gezahlt werden. Ist das nicht garantiert, entfällt die Möglichkeit der öffentlichen Förderung. Der Bund ist gerade vorangegangen, das Land Nordrhein-Westfalen ihm soeben gefolgt. In beiden Fällen werden die Mindesthonorare als Bedingungen in den Förderbescheiden etwa der Bundeskulturstiftung oder des Landes NRW festgeschrieben werden. Grundsätzlich ist die Begeisterung der Branche groß, aber es regen sich auch kritische Stimmen. weiterlesen …
„A Mentsh is a Mentsh.“ Der Antisemitismus und die Grundrechte, eine Diskussion in der Bundeskunsthalle
Der entscheidende Satz fiel am Schluss der Veranstaltung. „Die Meinungsfreiheit ist wie die Kunstfreiheit inhaltsneutral.“, hob der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers hervor, der unter anderem aus Anlass der Antisemitismusdebatte über die documenta 15 im Auftrag Claudia Roths ein Gutachten über die Grenzen der Kunstfreiheit verfasst hatte. Er sage das durchaus mit einem gewissen Unwohlsein, fügte er hinzu, aber das sei der harte Preis, den man in der liberalen Ordnung zu zahlen habe. Ein drittes Mal ging es kürzlich im Rahmen der Gesprächsreihe der Bundeskunsthalle „A Mentsh is a Mentsh.“ um die öffentliche Antisemitismusdebatte, die vor allem in Deutschland teils mit fast unerträglichen Zuspitzungen geführt wird. Auch in der Bonner Runde lagen die Ansichten der beteiligten Diskutanten, neben Möllers der Antisemitismusbeauftragte der Hessischen Landesregierung Uwe Becker und die deutsch-palästinensische Journalistin Alena Isabelle Jabarine – mit israelischem Pass, wie sie ausdrücklich betonte – weit auseinander. Endlich einmal wurde aber das Feld dieses komplexen Themas bis an seine Grenzen gehend und dennoch in Ruhe ausgeleuchtet. weiterlesen …
Über Defizite am Theater und wie sie entstehen
Etwa drei Milliarden Euro öffentliche Förderung stehen hierzulande Stadt- und Staatstheatern einschließlich Landesbühnen jährlich zur Verfügung. Eine Menge Geld! Dennoch kommt es am Ende eines Haushaltsjahres immer mal wieder zu Defiziten. Manchmal liegt es an einem zu leichtfertigen Umgang mit den bereitstehenden Haushaltsmitteln durch die künstlerische Leitung, wie vor mehr als 30 Jahren seitens des mittlerweile verstorbenen Generalintendanten des Staatstheaters Stuttgart, Wolfgang Gönnenwein. Der hatte zur Finanzierung seiner künstlerischen Ambitionen die sogenannte Bugwelle erfunden, mit der man Schulden aus dem alten Haushaltsjahr in schöner und steigender Regelmäßigkeit unter Einsatz der öffentlichen Gelder des neuen Haushaltsjahrs finanzierte. Das brachte ihm angesichts seines vorsätzlichen Verstoßes gegen die öffentlichen Haushaltsregelungen sogar ein Strafverfahren wegen Untreue ein, das dann aber gegen Auflagen eingestellt wurde. Zuweilen ist die Ursache aber erfreulicherweise harmloser. Nicht selten liegt sie in einer strukturellen Unterfinanzierung, also einer nicht ausreichenden Ausstattung des jeweiligen Theaterhaushaltes mit öffentlichen Mitteln, vor allem dann, wenn unvorhersehbare Ereignisse eintreten und diese auf die Ausgaben (oder Einnahmen) durchschlagen. weiterlesen …
Europa, die Künste und eine bevorstehende Wahl zum Europaparlament
Maria Lassnig war eine großartige und ebenso eigenwillige österreichische Künstlerin. Soeben ist der Film über ihr Leben unter dem Titel „Mit einem Tiger schlafen“ in den Kinos angelaufen. In genialer Weise wird diese hochsensible Künstlerin dargestellt von der wunderbaren Schauspielerin Birgit Minichmayr. Es ist eine Sternstunde des Kinos, ein einzigartiges Wechselspiel zwischen hoher körperlicher Empfindsamkeit einerseits und stoischer Beharrlichkeit gegenüber einer manchmal allzu arrogant daherkommenden Welt der Galerien und Kuratoren andererseits. Allein die Szene im österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig möchte man als Zuschauer nicht mehr missen. Maria Lassnig beklagt sich, sie könne bei der Lautstärke der ebenfalls dort installierten Videokunst ihre eigenen Arbeiten nicht „sehen“, und lässt dem einen fast dahingerotzten Vorwurf an den Kurator folgen, er habe sich ja nicht getraut, den Pavillon mit ihren Werken alleine zu gestalten. Welch eine Selbstbehauptung der eigenen Kunst! Doch hier soll es nicht um dieses cineastische Meisterwerk gehen. Vielmehr ist eine Einblendung vor Beginn des Films hervorzuheben, nämlich der Hinweis auf das Kulturförderprogramm der Europäischen Union, „Creative Europe“. Auch von dort floss offenkundig Geld für dieses sehenswerte Kinostück. weiterlesen …
Die Antisemitismusdebatte in der Kultur – ein Aufruf zu mehr Besonnenheit
„Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.“, dichtete einst Heinrich Heine. Das Zitat geht mir zunehmend nicht aus dem Kopf angesichts einer immer mehr sich verschärfenden Antisemitismusdebatte im Kulturbetrieb. Die Anzahl der um Augenmaß bemühten Diskursteilnehmer befindet im freien Fall. Zuspitzungen allerorten! „Geht es ein bisschen kleiner, ruhiger, vorsichtiger?“, möchte man so manchem zurufen. Doch die (nicht nur) durch die sozialen Medien überhitzte Gesellschaft beginnt, sich daran zu gewöhnen, dass offenkundig nur noch die Übertreibung die gewünschte Aufmerksamkeit erzielt. Zunehmend entsteht ein Zustand der Vergiftung, der für den Kulturbetrieb verhängnisvoll ist. Deswegen ist Abrüstung das Gebot der Stunde. weiterlesen …
Antidiskriminierungsklausel und Code of Conduct: Über die Grenzen der Kunstfreiheit
Seit den Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Documenta 15 führt die Kulturbranche hierzulande eine Debatte über die Freiheit der Kunst. Vor allem geht es um die Frage, in welcher Relation dieses hohe Gut unserer Verfassung zu anderen Rechten oder Wertvorstellungen steht. Begriffe wie Antidiskriminierung, Diversität, Rassismus und Antisemitismus bestimmen den Diskurs. Persönlichkeitsrechte und Menschenwürde werden der Kunstfreiheit entgegengesetzt. Während sich die Gesellschaft mehrheitlich auf bestimmte Rechte und Wertvorstellungen weitgehend verständigen kann, ist der Umgang mit ihnen in der Kunst umso schwieriger. weiterlesen …
Corona-Betrug bei den Salzburger Festspielen? Über den Sinn oder Unsinn von Strafanzeigen
Es ist ein beliebtes Mittel zur Erzielung von öffentlicher Aufmerksamkeit: Das Erstatten einer Strafanzeige. Jemand wendet sich an die zuständige Polizeistation oder an die Staatsanwaltschaft, um dort einen Sachverhalt mitzuteilen, mit dem angeblich eine Straftat begangen wurde. Soeben sind die Salzburger Festspiele von einer solchen Strafanzeige betroffen. Anlass sind Auseinandersetzungen über Gagenausfälle wegen der Corona-Pandemie. Ob Strafanzeigen dieser Art sinnvoll sind, ist mehr als fraglich. Oft sind sie auch nur eine unnötige Belastung des Justizapparates. weiterlesen …
Warum die Künstlersozialkasse für Kunst und Kultur auch nach 40 Jahren so wichtig ist
Kürzlich gab es in Berlin einen „großen Bahnhof“, wie es so schön heißt, wenn aus gegebenem Anlass viele Leute und einiges an Prominenz auflaufen. Es gab das 40-jährige Bestehen der Künstlersozialkasse zu feiern, ausgerechnet in der „Bar jeder Vernunft“. Gerade diese Tugend der Aufklärung kann man jedoch der KSK, wie sie verkürzt gerne genannt wird, nicht absprechen. Denn sie betreibt ein kompliziertes Versicherungsgebilde mit einer Renten-, einer Kranken- und einer Pflegeversicherung für selbstständige Künstlerinnen und Publizisten, und das mit einem hohen Maß an Sachverstand und Korrektheit. Und so bescheinigte der Bühnenlyriker Bas Böttcher zur Erheiterung des Geburstatgs-Publikums der Künstlersozialkasse „Bei all dem sich ständig mit Künstlern befassen, hast du dich nie verrückt machen lassen. Glanz und Pomp sind dir nie zu Kopfe gestiegen, du bist immer korrekt und nüchtern geblieben. Auch wenn die Klienten noch so krass fett rocken, du bleibst solide, sachlich und trocken.“ weiterlesen …
Sommerbespielung oder Sommerloch? Sollen die Theater im Sommer öffnen?
Ganz so einfach hat es die Kultur mit dem Sommerloch nicht. Wie immer gibt es zwar mal mehr mal weniger spektakuläre Inszenierungen in Salzburg oder Bayreuth, in Avignon und Aix en Provence. In Locarno werden die Filmfestspiele eröffnet und beim Piano-Festival in Roque d´Antheron reiht sich ein gut besuchtes Spitzenkonzert an das nächste. Auch sonst ist sommerlich einiges los hierzulande, von der Bachwoche in Ansbach über die Ruhrtriennale bis zum Musik Festival Schleswig-Holstein. Aber ein Ereignis wie die Documenta, die zuletzt den kulturpolitischen Erregungspegel auf dem Höhepunkt hielt? Fehlanzeige! Da nun fällt es dem Deutschen Kulturrat auf, dass es in Berlin gerade mal kein Theater gibt. Es sind Sommerferien. Nichts scheint da näher zu liegen, als zu fordern, die Schauspieler, Sängerinnen, Tänzer, Musikerinnen und wer sonst noch so im Theater beschäftigt ist, mögen doch mal raus aus der sommerlichen Hängematte. Damit endlich mal auch in der Hauptstadt etwas los ist. Deswegen soll Schluss sein in Zukunft mit den Sommerferien der Theater, nicht nur in Berlin, gleich in ganz Deutschland. Und schon gibt es im teils regnerischen, teils überhitzten August eine kleine Debatte. weiterlesen …
Die Kulturinstitution und ihre kaufmännische Geschäftsführung
Im Februar 2023 wurde der Abschlussbericht zur documenta 15 veröffentlicht, den das Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung dieser Ausstellung erstellt hatte. Mit Rücksicht auf die heftigen Antisemitismusvorwürfe gegen die Kasseler Veranstaltung war dieser mit Spannung erwartet worden und wurde dementsprechend auch ausführlich kommentiert. Man sah sich in den Antisemitismusvorwürfen hinsichtlich einzelner Ausstellungsstücke weitgehend bestätigt, betonte aber auch das Bemühen des Berichts, das kuratorische Konzept der künstlerischen Leitung nachzuvollziehen sowie das Spannungsverhältnis zwischen künstlerischer Freiheit und deren Grenzen aufzuzeigen. Eines blieb jedoch weitgehend unbeachtet: Das den Abschlussbericht verfassende Gremium hatte sich ausgiebig mit der Rolle der Generaldirektorin der Documenta gGmbH befasst. Es war dabei zu allgemeinen Erkenntnissen über die Aufgaben der kaufmännischen Leitung einer öffentlich getragenen Kulturinstitution gekommen. Diese Feststellungen lohnen ein genaues Hinsehen. weiterlesen …
Was zu beachten wäre. Ein Beitrag zur Reform von ARD und ZDF
Tom Buhrow hat kürzlich eine Rede gehalten. Darin ging es um die Reform von ARD und ZDF. Er sprach zwar nicht als WDR-Intendant und zurzeit amtierender ARD-Vorsitzender, wie er ausdrücklich betonte. So einfach ist es leider nicht. Man kann ja Ämter, die einem übertragen werden, nicht nach Bedarf einfach an- und ablegen wie einen Jägerhut. Oder sich mit einem Amt ausgestattet die Tarnkappe des Privaten überziehen, um bei öffentlicher Rede nicht aufzufallen. Nein, ein Intendant ist ein Intendant. Umso ernster muss man die Worte Buhrows und das, was er als Reformbedarf ausmachte, nehmen. Das gilt umso mehr, als es ziemlich wenig mit dem zu tun hat, was dem aufmerksamen Zuschauer im täglichen Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auffällt, um nicht zu sagen aufstößt. weiterlesen …
„Die Humanisierung der Organisation“ und was sie für Kultureinrichtungen bedeutet – eine Buchbesprechung
Es ließ die Kulturszene schon aufhorchen, als der Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, Peter Laudenbach, zusammen mit dem Wirtschaftsethiker Kai Matthiesen und der Soziologin Judith Muster ein Buch mit dem Titel „Die Humanisierung der Organisation“ vorlegte. Denn kaum ein Titel hätte sich besser einfügen können in die allgemeine vor allem in Theatern und Orchestern geführte Debatte über Machtmissbrauch und Machtkontrolle, geht es doch in dieser Debatte vor allem um den Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor der sooft bemühten (eher eingeschränkten) Alleinherrschaft (einzelner) egomaner Intendanten und Intendantinnen. Bei genauem Hinsehen mögen jedoch manchem schon Zweifel am Nutzen des Buches gekommen sein, wenn es im Untertitel heißt: „Wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert“. Das liegt so gar nicht auf der Linie interner, oft sehr emotional geführten Auseinandersetzungen über die Struktur eines Kulturbetriebs. Umso mehr drängt es den interessierten Kulturbeobachter zu erfahren, was hinter der 250 Seiten starken Publikation steckt. weiterlesen …
Über kollektive Verantwortung in Kultureinrichtungen
Es ist in den letzten Jahren über die Macht der Intendantinnen und Intendanten viel geschrieben worden. Strukturveränderungen wurden gefordert, um ihre Befugnisse einzuschränken, zumindest stärkerer Kontrolle zu unterwerfen. Auch auf dieser Seite war davon schon die Rede (siehe am Schluss des Beitrags). Zunehmend wurde die Übertragung von Leitungsfunktionen auf ein Kollektiv als Allheilmittel angesehen. Das änderte sich schlagartig, als die Debatte über die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta fifteen hochkochte und sich die Frage nach der künstlerischen Verantwortung für die Ausstellung stellte. Die nämlich war dem indonesischen Künstler-Kollektiv ruangrupa übertragen worden, was es natürlich schwer machte, den einzelnen Kopf, der rollen sollte, zu finden. Am Ende traf es die Generaldirektorin Sabine Schormann, letztlich weniger, weil ihr für die inhaltliche Seite der Documenta tatsächlich die Verantwortung übertragen worden wäre (war wohl nicht), sondern mehr wegen ihres nicht unbedingt geschickten Umgangs mit dem Konflikt. Nun reden alle davon, man müsse die Documenta umstrukturieren, was sich natürlich immer gut anhört, aber noch lange nicht bedeutet, dass das Wie geklärt ist. weiterlesen …
Die Documenta und die Freiheit der Kunst
Anlässlich der documenta fifteen wurde in jüngster Zeit so viel wie schon lange nicht mehr öffentlich über das Thema Kunstfreiheit debattiert. So sehr es dabei auch um Politisches ging, zunächst ist diese Thema wohl ein juristisches. Denn die Freiheit der Kunst ist in Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz verankert und hat in der Geschichte dieser unserer deutschen Verfassung zahlreiche, meist sehr kunstfreundliche Gerichtsurteile des Bundesverfassungsgerichts hervorgebracht. Nicht jedem, der sich an der öffentlichen Debatte über die documenta fifteen und das dort gezeigte Bild People´s Justice von Taring Padi sowie dessen antisemitische Elemente beteiligte, schien sich dessen bewusst zu sein. Viel zu leichtfertig wurden Statements zu den Grenzen der Kunstfreiheit geäußert. Statt aus politischen Gründen das Abhängen des Bildes zu verlangen, leuchteten Politiker und Medien die Grenzen der Kunstfreiheit schlagwortartig aus, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Damit wurde der Versuch gemacht, für die Grenzen der Kunstfreiheit öffentlich Maßstäbe zu setzen, was schon deswegen scheitern musste, weil es wie so oft in solchen öffentlichen Diskursen an der notwendigen Differenzierung fehlte. weiterlesen …
Das Theatermodell Karlsruhe
Über Transformation in Kultureinrichtungen wird augenblicklich viel gesprochen und geschrieben. Was ihr Ergebnis sein soll, steht dabei eher theoretisch fest: Mehr Partizipation, mehr Transparenz, kollektivere Entscheidungsprozesse, Einschränkung von Machtbefugnissen. Wie dieses Ergebnis aber konkret zu gestalten ist, war bisher kaum Gegenstand der Debatte. Jedenfalls sei die herrschende Klasse in den Theatern, Orchestern oder Museen dagegen, heißt es, denn sie wolle von ihren Machtansprüchen angeblich nicht lassen. Die Führungskräfte versuchten Strukturanpassungen zu vermeiden, „um ihre eigene Stelle im System nicht zu gefährden“ (so in einem Beitrag auf der Internet-Seite des Deutschen Kulturrats). Eine ganz andere Sprache sprechen nun die neusten Umstrukturierungen am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Dort hat kürzlich der Verwaltungsrat des Theaters nach einem langen und aufwendigen Entscheidungsprozess das „Theatermodell Karlsruhe“ im Einvernehmen mit der dortigen Theaterleitung verabschiedet. Beschlossen wurden keine großen Worte, beschlossen wurde das Ende der Generalintendanz zugunsten eines kollektiven Leitungsmodells. weiterlesen …
Putin oder nicht Putin? Die private Gesinnung und die Kündigung von Künstlerverträgen
Krieg in Europa! Russland hat die Ukraine überfallen. Seitdem stehen russische Künstlerinnen und Künstler in der ganzen übrigen Welt unter verschärfter Beobachtung. Nach der Haltung zu Putin und seinem menschenverachtenden Angriffskrieg werden sie befragt. Walerie Gergijew bei den Münchener Philharmonikern: Wegen mangelnder Distanz zu Putin gekündigt. Anna Netrebko: Aus gleichem Grund Absagen durch die Metropolitan Opera in New York und die Staatsoper Berlin. Es gibt heftige Debatten. Den einen sind jenseits des militärischen Eingreifens der Nato viele Mittel recht, von denen sie vermuten, damit Putin unter Druck setzen zu können. Die anderen warnen vor massiven Einschränkungen der Kunstfreiheit, argumentieren gegen jede Form der Gesinnungsschnüffelei. Doch wie ist die Rechtslage? Wie immer kompliziert! weiterlesen …
Hohe Erwartungen an die Bundeskulturpolitik
Es vergeht kein Bundestagswahlkampf, ohne dass Exponenten des deutschen Kulturlebens oder solche, die sich dafür halten, zwei Forderungen artikulieren: Erstens brauchen wir einen Bundeskulturminister (anstelle eines Staatsministers im Kanzleramt) und zweitens eine Kulturklausel im Grundgesetz. Zuweilen nehmen Parteien diese Forderungen herzlich gerne in ihre Wahlprogramme auf, wohl weniger, weil sie von den Forderungen überzeugt sind, sondern eher nach dem beliebten Motto: Klingt gut und kostet nichts. Der politische Fachjargon nennt so etwas Symbolpolitik. Statt sich also mit solchen eher an der Oberfläche verharrenden Forderungen zu befassen, ist zu fragen, was der Bund Wesentliches zum Kulturleben dieses Landes und vor allem zur Pflege der Künste beitragen kann und sollte. Die genannten Forderungen ablehnen, heißt also keineswegs, dass auf eine Bundeskulturpolitik zu verzichten wäre. Im Gegenteil! Es ist gerade am Anfang einer neuen Legislaturperiode sinnvoll, einmal mehr den Versuch zu machen, ihre Rolle zu definieren. weiterlesen …
Apps, VR-Brillen und andere Kultur-Videoprojekte aus Sicht des Urheberrechts
Mit allem Möglichen hatten die Theater (und andere Kultureinrichtungen) gerechnet, aber mit einer Pandemie, die ihnen für Monate die Säle zusperrt, sicher nicht. Also war guter Rat teuer. Dass Theater auf dem Bildschirm den Betrachter faszinieren kann, wollten viele zuvor nicht glauben. Ja, schon die Forderung, doch urheberrechtlich zumindest mal aufs Digitale vorbereitet zu sein, galt fast schon als eine Art Verrat an den Bühnenkünsten. Nun, kaum machte Corona die Runde, kamen die Bühnen des Landes gar nicht umhin, sich der Frage nach ihren digitalen Angeboten zu stellen. Vorbereitet war darauf fast niemand. Also wurde im Internet bereitgestellt, was man auf die Bildtonträger des Hauses vorsichtshalber aufgezeichnet hatte. Es folgten, als es mit der Pandemie länger dauerte, Streaming-Premieren. Das große Nachdenken im Sinne von „Was tun?“ begann. Nun reden alle über Apps, Virtual-Reality(VR)-Brillen und andere Projekte im Netz. Urheberrechtlich wirft das viele Fragen auf, denen so richtig bisher nicht nachgegangen wurde. weiterlesen …
Der Entwurf eines Kulturgesetzbuchs NRW, Meilenstein der Kulturförderung oder vages Versprechen?
Es klingt auf den ersten Blick eher sperrig: Kulturgesetzbuch NRW. Die Künste eingezwängt in eine Ansammlung von Statuten? Braucht das jemand? Sind die Künste nicht frei? Diese Freiheit zu sichern, dient die öffentliche Förderung, vor allem durch die Kommunen und Länder, natürlich auch durch den Bund. Doch gerade dieser Schutz der Freiheit reicht als Legitimation oft nicht aus. Gefordert wird dann, Kultur solle Pflichtaufgabe der Gemeinden werden, obwohl es die freiwilligen Aufgaben sind, die das Leben einer Stadt ausmachen. Das aber wird am Ende niemanden interessieren, wenn es demnächst in Stadt und Land um das liebe Geld geht, was coronabedingt fehlen wird. Deshalb ist es wichtig, sich den nun von der Landesregierung in NRW vorgelegten Gesetzentwurf einmal näher anzusehen. weiterlesen …
Über die Digitalisierung der Kulturangebote
Ich gestehe es offen: Nichts nervt mich zurzeit mehr als der Satz „Die Veranstaltung findet online statt.“. Es sei im kostenlosen Stream mal wieder zu sehen, was in normalen Zeiten Großartiges im Theater auf die Bühne gebracht oder als Ausstellung im Museum gezeigt würde. Zugleich wird ein Musiker, der die Menschen mit ebenfalls vergütungsfreien Twitter-Konzerten erfreut, zurecht bewundert und geehrt. Ja, als erste Reaktion auf die Kultur-Katastrophe Corona waren solche Angebote verständlich, sogar sinnvoll und geboten. Aber wie soll es weitegehen? So sicher nicht. Dafür stellen sich zu viele Fragen, die sich aber vor allem die Apologeten der Digitalisierung nicht stellen. Es ist deshalb höchste Zeit, es zu tun. weiterlesen …
Wohin die Reise führt? Über die Zukunft der Theater und die soziale Lage der Künstler
Die Theater sind vorläufig geschlossen. Wann es live wieder so richtig weitergeht mit Hamlet und Faust, mit Performativem und Literarischem, mit Oper, Konzert und Tanz weiß niemand. Auch nicht, ob es überhaupt einen Weg zurück gibt in die alte Routine. Manch einer sieht im augenblicklichen Stillstand eher eine Chance zu einer Art Neuanfang, zu einer Veränderung. Während, solche Erwartungen vor Augen, ein Teil der Theaterbelegschaft mit Kurzarbeitergeld und den öffentlichen Zuschüssen die Zeit finanziell abgesichert überbrückt, nimmt die Unruhe bei denen, die mit kurzfristigen Verträgen im Theater unterwegs waren, verständlicherweise zu. Also stellt sich umso mehr die Frage wie die Zukunft des Theaters aussehen mag, was gegebenenfalls für die Künstlerinnen und Künstler zu tun ist. weiterlesen …
Schluss mit dem Hin und Her! Theater und Konzertsäle brauchen mehr Rechtssicherheit im öffentlichen Raum!
Immer mehr frage ich mich, welche Rolle eigentlich Verwaltungsjuristen beim Erlass so mancher Corona-Verordnung spielen. Fühlen sie sich ausschließlich als Vollzugsorgan der politischen Vorgaben und haben sämtliches kritische Denken eingestellt? Nur so lassen sich die zahlreichen Entscheidungen, mit denen Gerichte zunehmend die Verordnungen oder Teile davon kippen, noch erklären. Auch das politische Bewusstsein für das richtige Maß zwischen Gesundheitsschutz und Wahrung der Rechtsordnung scheint mit den steigenden Infektionszahlen offenkundig auf dem Sinkflug. Es ist daher, auch angesichts des neusten Lockdown, an der Zeit, noch einmal einigen juristischen Corona-Problemen nachzugehen. weiterlesen …
Über die Macht im Theater und anderswo
Das Theater ist ein bemerkenswerter Betrieb. Es bringt künstlerisch alles Mögliche hervor: großartige Aufführungen, manche Langeweile, viel Routine und immer wieder Überraschendes, Neues. Aber er ringt auch mit vielen Unzulänglichkeiten, hierzulande ebenso wie anderswo in der Welt. Jeder, der mit dem Theater zu tun hat, weiß von diesen Unzulänglichkeiten eine Menge zu erzählen. Fehlendes Geld und rausgeschmissenes Geld, brüllende Regisseure und schwierige Regisseurinnen, Lügen und Intrigen, gelangweilte Musikerinnen und Musiker, großartige Künstlerinnen und Künstler und manche, die nur glauben es zu sein. Oft ein Feuerwerk der Eitelkeit! Zugleich aber gibt es grenzenlose Phantasie, viel Kreativität und Einfallsreichtum sowie ein hohes Maß an Engagement für die Sache Theater. Viele wunderbare und liebenswerte Menschen, die den Betrieb in Gang halten, ihm oft große Momente der Musik, der Kunst verleihen. Kurz und gut, das Theater ist eine Ansammlung von Begabung, ja zuweilen Genialität, gekoppelt mit menschlichen Schwächen, mit Arroganz und Unsicherheit. Das Leben eben, wie es so ist. Und tritt alles mal wieder deutlicher zutage, dann kommen die Experten daher und reden etwas von Strukturproblemen, von Machtstrukturen, die es aufzulösen gelte. weiterlesen …
Was die Corona-Kulturhilfe des Bundes im Bereich der darstellenden Kunst leistet und was nicht
Eine volle Milliarde Euro stellt der Bund dem von der Corona-Krise stark angeschlagenen Kulturbereich zur Verfügung. Das ist eine Menge Geld. „Kunst und Kultur sollen zur Wiederaufnahme ihrer Häuser und Programme ertüchtigt werden.“, heißt der einleitende Satz der einschlägigen Nummer 16 des Koalitionsbeschlusses vom 3. Juni 2020. Das klingt zunächst gut, hat aber seine Tücken. Grund genug, einmal genauer hinzusehen und vor allem Anregungen zu geben, was bei der Umsetzung bedacht werden sollte. Denn davon wird vieles abhängen, wenn Kunst und Kultur wirklich geholfen werden soll. weiterlesen …
Die Corona-Sorgen der Kultur
Die Unruhe steigt. Zunehmend zeichnet sich ab, dass die Corona bedingten Einschränkungen des Kulturbetriebs länger dauern als erwartet. Museen haben zwar wieder geöffnet, aber unter erheblichen Auflagen. Die Theater ringen um ein Zukunftsszenario. Wie und wann welche Filme gedreht werden können, ist kaum absehbar. Kinos fürchten um ihre Existenz. Doch der Bund zögert mit konkreter Hilfe für die Kultur. Das Zögern kann sich als hoch dramatisch erweisen für eine der bedeutendsten Kulturlandschaften der Welt. weiterlesen …
Was tun? Über Corona und die Möglichkeit, Theater und Konzertsäle wieder zu öffnen
Es geht voran. Die Geschäfte sind wieder geöffnet, die Museen wieder zugänglich, wenn auch mit Einschränkungen. Anfang Mai haben sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten auf weitere Lockerungen des Corona bedingten Lockdowns verständigt. Zum ersten Mal war auch von der Öffnung der Theater und Konzerthäuser die Rede. Das ist erfreulich, gehören sie doch zu den am stärksten betroffenen Einrichtungen. Aber die Frage ist: Wie könnte eine solche Öffnung aussehen? weiterlesen …
Gastverträge und Gagenzahlung – Zur Umfrage von Ensemble-Netzwerk
Es steht außer Zweifel: Viele darstellende Künstler und Künstlerinnen, vor allem Schauspieler, Sänger und Tänzer, die regelmäßig nur für eine einzelnen Produktion oder eine einzelne Aufführung von den Theatern beschäftigt werden, befinden sich nach Ausbruch der Corona-Krise und der Schließung der Theater in großer Not. Mehr als 32.000 solche Verträge insgesamt schließen allein die Stadt- und Staatstheater sowie Landesbühnen jährlich ab, Tendenz steigend. Und es ist richtig: Viele dieser Beschäftigten sind trotz der jeweiligen Kurzfristigkeit ihrer Tätigkeit Arbeitnehmer. Ihnen nutzen also die Hilfsprogramme für Soloselbstständige oder solche für Künstler, die in der Künstlersozialkasse versichert, also ebenfalls selbstständig tätig sind, nichts. Bestätigt wird dies alles durch eine aktuelle Umfrage von Ensemble-Netzwerk. Doch vielleicht greift diese doch zu kurz. weiterlesen …
Corona-Hilfsprogramm für Kunst und Kultur
Derart massive Eingriffe in das öffentliche Leben, wie sie zurzeit bedingt durch das Corona-Virus stattfinden, hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Für die Menschen hierzulande sind diese Eingriffe mit erheblichen Einbußen an Lebensqualität verbunden. Zudem sind die Folgen für die Gesellschaft, der die Öffentlichkeit – wenn auch nur temporär – wegbricht, nicht abzusehen. Das gleiche gilt erst recht für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der Corona-Krise verbunden sind. Vor allem ist die Veranstalterbranche, einer der größten Wirtschaftszweige, betroffen. Künstlerinnen und Künstler erhalten wegen ausgefallener Auftritte keine Honorare, Firmen für technisches Equipment stehen vor dem Aus, Veranstaltern brechen die Einnahmen weg. Zu Recht fordert der Deutsche Kulturrat hier staatliche Hilfe. Doch zu fordern ist leicht. Eine solche Hilfe umzusetzen weit schwieriger. Zu fragen ist also: Was genau tun? Dazu einige erste Überlegungen. weiterlesen …
Soziale Kompetenz statt neuer Theater-Strukturdebatte
Fast 30 Jahre reden wir in den Kulturbetrieben über Strukturen. Nun gibt es die Studie „Macht und Struktur am Theater“ von Thomas Schmidt. Gebracht haben die Debatten bisher nicht viel, zumindest nichts zugunsten des Theaters. Langsam fragt man sich, worum es eigentlich geht. Und woran es wirklich fehlt. weiterlesen …
Für ein Kulturabkommen zwischen EU und Großbritannien
Die Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2020 war für Europa eine traurige Nacht. Sicher, es passiert in der Welt zurzeit viel Schlimmeres als der Brexit. Aber eine Europäische Union ohne England, das schmerzt schon ein wenig, auch aus Sicht der Künste. Zunächst bleibt bis Ende des Jahres zwar irgendwie alles beim Alten. Aber man hat es ja schon vor Augen, das Gerangel um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Zudem ist zu fragen, ob ein solches Abkommen der Kunst und der Kultur in Europa überhaupt helfen wird? weiterlesen …