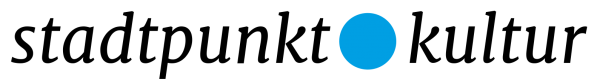Die Verbindlichkeit
So stellt sich unter anderem die Frage nach der Verbindlichkeit. Der Bund überlässt die Festlegung der Honoraruntergrenzen den „bundesweiten Empfehlungen der jeweils einschlägigen Berufs- und Fachverbände der Künstlerinnen, Künstler und Kreativen.“ Ein Blick auf die Vielfalt der Verbandsstrukturen im Kulturbereich zeigt, wie schwierig es sein kann, zu eindeutigen Ergebnissen zu gelangen. Hier wird es dringend erforderlich sein, schnell zu Verständigungen zu kommen, will man den Förderstrukturen des Bundes die notwendige Orientierung geben.
Auch in NRW hat man sich eine Zeit lang um verbindliche Regelungen herumgedrückt. Zunächst sah der § 16 Abs. 3 Kulturgesetzbuch NRW im Entwurf nur eine Anknüpfung an die gesetzliche Mindestlohnregelung vor. Als es daran Kritik gab (siehe z.B. https://stadtpunkt-kultur.de/2021/06/der-entwurf-eines-kulturgesetzbuchs-nrw-meilenstein-der-kulturfoerderung-oder-vages-versprechen/) änderte man die Vorschrift. Heute lautet die einschlägige Regelung:
„Bei allen Förderungen des Landes sind Honoraruntergrenzen zu beachten, die von dem für Kultur zuständigen Ministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und den jeweiligen kulturellen Fachverbänden erarbeitet werden. Bundesweite Empfehlungen sind hierbei zu beachten. Das Nähere regelt eine Richtlinie.“
Diese Regelung ist seit dem 1. Januar 2022 (!) in Kraft. Auch sie ließ viel Spielraum. Nun geht es voran, allerdings zunächst nur mit zwei Landesprogrammen der Kulturellen Bildung. Endlich beginnen will man ansonsten erst am 1. Januar 2026. Dann soll es wohl die im Gesetz vorgesehene Richtlinie geben, nach der dann die Landesregierung im Sinne der Selbstbindung bei der Mittelbewilligung zu verfahren hat.
Für wen die Mindesthonorarregelungen gelten
Interessant wird der Geltungsbereich der Honorarregelungen sein. Das Wort „Honorar“ lässt darauf schließen, dass es um die Vergütungen von selbstständig tätigen Künstlerinnen und Künstlern gehen wird. Das wäre fragwürdig. Schon bei den Corona-Hilfen im Bereich der Künste hatten fast alle getroffenen Regelungen genau das Problem, dass sie sich nur an die Selbstständigen wandten, nicht an die abhängig Beschäftigten. Gerade im Bereich der darstellenden Künste sind aber zahlreiche Beschäftigungsverhältnisse, selbst wenn sie nur einen einzelnen Tages-Einsatz einer Künstlerin vorsehen, Arbeitsverhältnisse. Würden hier die in Aussicht genommenen „Mindesthonorarregelungen“ nicht greifen, gingen sie vor allem für viele Tänzer und Schauspielerinnen, Musikerinnen und Sänger ins Leere. Und was ist eigentlich mit all den nichtkünstlerisch Tätigen, die an einem Projekt beteiligt sind? Soll für die auch die Mindesthonorarregelung gelten? Hier steckt also die Tücke im Detail.
Wohin die Mindesthonorarregelungen führen können
Was gut klingt, ist aber nur dann wirklich gut, wenn dafür das notwendige Geld da ist. Die erste Rechnung dazu ist noch mehr als einfach. Stehen in einem Fördertopf (vom Bund oder dem Land NRW) beispielsweise 200.000 Euro zur Verfügung und hat man damit insgesamt 20 Projekte mit 10.000 Euro gefördert, ohne auf Mindesthonorare zu achten, dann wäre mal nachzurechnen, was die 20 Projekte denn unter Einhaltung der Mindesthonorare kosten würden. Verteuerte die Mindesthonorarregelung jedes der Projekte um 10 Prozent, dann muss entweder der Fördertopf um 10 Prozent erhöht werden oder es werden etwa zwei Projekte weniger gefördert. Dass gerade die Fördertöpfe sich vergrößern, ist allenthalben nicht zu hören. Dann aber lautete die einfache Konsequenz: Weniger Kunst für bessere Bezahlung.
Schwieriger wird die Rechnung dadurch, dass viele Projekte einer Komplementärförderung etwa durch die Kommunen bedürfen. Kann also die Bundeskulturstiftung zum Beispiel noch den Förderbetrag erhöhen, um die Mindesthonorare zu finanzieren, bleibt völlig offen, ob die komplementär fördernde Kommune auch dazu in der Lage (oder bereit) ist. Ist sie es nicht, erhöht dann die Bundeskulturstiftung ihrerseits den Förderbetrag noch einmal, um die wegen der Mindesthonorare entstehenden Fehlbeträge aufzufangen, oder fällt die öffentliche Förderung des Projektes dann aus? Oder wird es etwa nur kommunal gefördert, was dazu führen würde, dass die Vergütung der Künstlerinnen und Künstler viel weiter hinter den nun in Aussicht genommenen Mindesthonoraren zurückbleiben würde.
Doch das größte Problem bleibt die Förderung zahlloser Projekte, bei denen von vorneherein klar ist, dass keinesfalls die vorgesehenen Mindesthonorare gezahlt werden können. War es bisher möglich, solche Projekte zu fördern, um die krassesten Fälle der Selbstausbeutung von Künstlerinnen und Künstlern zu vermeiden, fällt diese Förderung bei der Einführung von Mindesthonorargrenzen eindeutig weg. Kleinprojekte drohen also völlig ins Abseits zu geraten. Zugespitzt ist zu fragen: Ist es der Künstlerin lieber, dass ihr Projekt ausfällt oder fast nur ohne Vergütung realisierbar ist, dafür aber Projekte anderer Künstler mit Mindesthonorargarantie gefördert werden, weil die beteiligten Künstler bereits etabliert sind und dadurch gewisse Eigeneinnahmen generieren können? Das wäre ein neues Zweiklassensystem der öffentlichen Förderung, an dem niemand Interesse haben kann. Also sollte es unbedingt auch in Zukunft Förderstrukturen jenseits der Mindesthonorarregelungen geben, gerade um dem Entlegenen eine Chance zu geben.