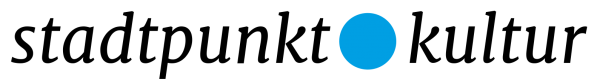Ganz oben auf der Agenda öffentlicher Kultureinrichtungen, also von Theatern, Museen und Orchestern, steht seit Jahren die kulturelle Bildung. Es gibt kaum noch ein Statement zur öffentlichen Finanzierung dieser Institutionen, ohne die bildungspolitische Bedeutung der täglichen Kulturarbeit hervorzuheben. Allen voran gilt das für Kinder- und Jugendtheater. Überall schießen Projekte mit Kindern und Jugendlichen wie Pilze aus dem Boden. Veranstaltet werden Mitsingkonzerte, Theater- und Tanzworkshops, Malkurse oder Einführungen in die Musik- und Instrumentenkunde. Getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber!“ wird für solche Aktivitäten dann geworben, vor allem im Internet. Was aber könnte eine bessere Werbung sein als Bilder von fröhlichen, aufmerksamen und begeisterten Kindern? Und so findet man diese auf den Internetseiten der Veranstalter oder gar in den sozialen Medien. Doch jetzt sorgt eine Entscheidung der italienischen Datenschutzbehörde für Aufmerksamkeit. Sie verhängte gegen einen Kindergarten ein saftiges Bußgeld von 10.000 Euro, unter anderem weil dieser Fotografien von den dort aufgenommenen Kindern im Netz verbreitet hatte. Das Besondere an dieser Bußgeldentscheidung ist, dass die Eltern der Verbreitung ausdrücklich zugestimmt hatten, was der Datenschutzbehörde jedoch nicht ausreichte. Eltern hätten, so die Behörde, das Wohl des Kindes im Auge zu behalten. Tun sie das nicht, seien ihre Einwilligungen rechtlich wirkungslos. weiterlesen …
Der Fall und die EU-Datenschutzgrundverordnung
Nun mag man sich fragen, ob eine solche Entscheidung in Italien für die Werbeaktivitäten von Kultureinrichtungen hierzulande überhaupt relevant ist. Formal ist das zu verneinen, erst recht, weil es sich nicht einmal um eine Gerichtsentscheidung handelt. Aber auch inhaltlich sind die Verhältnisse unterschiedlich. Die Kinder, um die es in Italien ging, waren sechs Jahre alt oder deutlich jünger, teils sogar Säuglinge. Veröffentlicht im Netz wurden Fotos aus einem typischen Tagesablauf der Kinder, „darunter“, wie es in dem Bußgeldbescheid heißt, „auch in besonders heiklem Kontext (Schlaf, Kantine, Benutzung der Hygieneeinrichtungen, Windelwechsel, Massagen)“. Das lässt sich mit Fotografien aus einem Kulturprojekt für Kinder keinesfalls vergleichen. Es fehlte zudem an ausreichender Information der Eltern durch den Kindergarten über die beabsichtigte Veröffentlichung der Fotos.
Andererseits war Grundlage der Bußgeldentscheidung die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), die nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland wie in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten direkt gilt. Deshalb lohnt sich sowohl ein Blick auf die Begründung des gegen den Kindergarten gerichteten Bescheides als auch eine Betrachtung der in Deutschland bestehenden Rechtslage.
Die Einwilligung der Eltern
Da es sich bei der Verbreitung von Fotografien oder Videos im Internet um eine Datenverarbeitung handelt, muss für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung eine der in § 6 Abs. 1 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sein. In der Regel wird deshalb von Kultureinrichtungen, die mit Kinderfotografien oder gar Videoaufzeichnungen von ihren Projekten zu Werbe- und Informationszwecken ins Netz gehen wollen, dafür die Einwilligung der Eltern eingeholt (§ 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO), sofern die Kinder unter sechzehn Jahre sind; sechzehn- bis achtzehnjährige Jugendliche können selbst zustimmen.
Einwilligungen im Sinne der DSGVO müssen nicht schriftlich erfolgen. Aus Beweisgründen werden sie aber in der Regel schriftlich sein. Nach § 1629 Abs. 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) üben die Eltern die Vertretung des Kindes gemeinschaftlich aus, also muss die Einwilligung in der Regel auch von beiden Elternteilen unterschrieben werden, so auch der in Italien erlassene Bußgeldbescheid. Anders kann die Situation sein, wenn die Eltern beispielsweise geschieden sind oder das Kind geboren wird, ohne dass die Eltern verheiratet sind. Vorsorglich sollte die vorformulierte Einwilligungserklärung deshalb die „Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten“ vorsehen und vielleicht sogar auf das gemeinsame Vertretungsrecht aufmerksam machen. Hat dann nur ein Elternteil unterschrieben, taucht die Frage auf, ob die Kultureinrichtung dem weiter nachgehen muss. Nach § 8 Abs. 2 DSGVO hat der Verantwortliche, also die Kultureinrichtung, „angemessene Anstrengungen“ zu unternehmen, um sich zu vergewissern, dass eine wirksame Einwilligung vorliegt. Dem ist mit der oben vorgeschlagenen Formulierung der Unterschriftenzeile im Einwilligungsformular plus Ergänzung ausreichend Rechnung getragen. Enthält dann das Formular nur eine Unterschrift, darf davon ausgegangen werden, dass es dafür einen Grund gibt. Es entspräche zudem nicht dem Persönlichkeitsrecht des Kindes, wenn dann die Kultureinrichtung Nachforschungen darüber anstellen würde, ob die Eltern des Kindes etwa geschieden sind.
Die weiteren Voraussetzungen für die Einwilligung sind in DSGVO ausdrücklich aufgeführt. Dazu gehören eine ausreichend verständlich formulierte Unterrichtung über die beabsichtigte Datenverarbeitung (§ 7 Abs. 2 DSGVO), hier die Verbreitung von Bildern im Internet, die Freiwilligkeit der Einwilligung (§ 7 Abs. 4 DSGVO) sowie das Recht zum Widerruf der Einwilligung (§ 7 Abs. 3 DSGVO), über das der Einwilligungsberechtigte vorab zu informieren ist.
Freiwilligkeit der Einwilligung
Von der Datenschutzbehörde in Italien wurde die Freiwilligkeit infrage gestellt, wenn von der Zustimmung zur Veröffentlichung der Fotos der Zugang zu einem Bildungsangebot abhängig gemacht wird. Da die Veröffentlichung in der Regel für die Durchführung eines für Kinder angebotenen Projektes nicht wirklich erforderlich ist (die Werbung für die Veranstaltung reicht als Erforderlichkeit wohl kaum aus), kommt § 7 Abs. 4 DSGVO zur Anwendung. Diese Vorschrift schließt aber nicht grundsätzlich jede Verknüpfung zwischen „der Erbringung einer Dienstleistung“ und der Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus. Gefordert wird lediglich, dass dem Umstand der Verknüpfung und der daraus sich ergebenden Einschränkung der Freiwilligkeit „größtmöglich Rechnung getragen“ wird. Daraus ist zu schließen: Je notwendiger die angebotene Dienstleistung für das Kind ist (z.B. Schule oder Kindergarten), desto größer ist der Druck, der von der Verknüpfung zwischen der Dienstleistung und der Einwilligungserklärung ausgeht. Wird hingegen ein Kulturprojekt für Kinder angeboten, an dem diese völlig freiwillig teilnehmen können, und findet dies, wie etwa ein Mitsingkonzert oder eine Theateraufführung, auch noch im öffentlichen Raum statt, wird es eher legitim sein, die Teilnahme und die Einwilligung in die Verbreitung von Bildern, auch bewegten Bildern, miteinander zu verknüpfen. Die Situation ist praktisch keine andere als bei einem Vertragsabschluss nach § 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO (s.u.).
Das Widerrufsrecht
§ 7 Abs. 3 DSGVO sieht ausdrücklich vor, dass eine Einwilligung zur Verarbeitung von Daten jederzeit auf einfachem Wege widerrufen werden kann. „Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.“, so heißt es in der genannten Vorschrift ausdrücklich. Sind nun zum Beispiel Fotografien von einem Kulturprojekt mit Kindern bereits gemacht, aber die Verbreitung im Netz noch nicht erfolgt, ist die Veröffentlichung der Bilder, auf dem das Kind abgebildet ist, dessen Eltern widerrufen haben, nicht mehr möglich. Das ist bei Großaufnahmen des betroffenen Kindes leicht sicherzustellen. Bei Gruppenaufnahmen wird dies jedoch schwierig. Gegebenenfalls kann selbst das Gruppenfoto dann gar nicht mehr veröffentlicht werden. Ist die Veröffentlichung schon erfolgt, muss das Foto im Falle des für ein einzelnes Kind erfolgten Widerrufs möglicherweise vom Netz genommen werden.
Alternativen zur Einwilligung
Da die Einwilligung einschließlich des in der DSGVO verankerten Widerrufsrechts also auf wackeligen Füßen steht, muss man nach Alternativen für die Legitimation der Verbreitung von Kinderbildern und -videos, die von Kulturprojekten im Internet veröffentlicht werden sollen, Ausschau halten. Das deutet auch der Bußgeldbescheid der italienischen Datenschutzbehörde an und greift auf § 6 Abs. 1 Buchst. f zurück. Diese Vorschrift berechtigt zur Verarbeitung von Daten ohne ausdrückliche Einwilligung, wenn das zur Wahrung eines öffentlichen Interesses erforderlich ist und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, also des Kindes, nicht überwiegen. Das ist also ebenso eine Vorschrift, die mit großen Unsicherheiten verbunden ist.
Notwendig ist ein Vertrag
Ein Ausweg ist § 6 Abs. 1 Buchst f DSGVO. Die Vorschrift erlaubt die Datenverarbeitung und damit auch die Verbreitung von Daten, wenn diese für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist. Über die Mitwirkung eines Kindes an einem Projekt der kulturellen Bildung sollte also ein Vertrag abgeschlossen werden. Auch ein solcher Vertrag bedarf nicht der Schriftform. Es empfiehlt sich aber das Ausfüllen und die Unterzeichnung eines Anmeldeformulars durch den/die Erziehungsberechtigten (s.o. zur Einwilligung). Inhaltlich muss das Formular nicht nur die Durchführung der Bildungsmaßnahme erfassen, sondern auch die Mitwirkung an der Foto- und/oder Video-Dokumentation. Gleichzeitig lässt sich die Kultureinrichtung das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegeschränkte „einfache Nutzungsrecht“ an den Fotos und der Videoaufzeichnung einräumen. Dann sind die Mitwirkung und die Nutzung Gegenstand des Vertrages, sodass die Verarbeitung und die Verbreitung der Daten zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Der Vertrag kommt zustande, indem die Einrichtung die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung bestätigt. Das alles kann auch im E-Mail-Verkehr abgewickelt werden, allerdings nicht ohne die Unterschriften der Erziehungsberechtigten. Für die Annahme des Vertrages reicht in der Regel eine normale E-Mail aus. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass auch eine eventuelle urheberrechtliche Problematik mitgelöst ist. Schließlich haben die Kinder gegebenenfalls ein Leistungsschutzrecht, wenn sie singend oder spielend an einer Aufführung mitwirken. Falls dies, wie es im Kinder- und Jugendtheater durchaus der Fall sein kann, semiprofessionell geschieht, kann natürlich auch ein echter Beschäftigungsvertrag mit entsprechendem Inhalt abgeschlossen werden. Allerdings ist spätestens dann auch das Jugendarbeitsschutzgesetz zu berücksichtigen.
Ein weiterer Vorteil der vertraglichen Rechtsgrundlage liegt zugleich in dem damit verbundenen Ausschluss des auf die Datenverarbeitung begrenzten Widerrufs. Wollen sich die Erziehungsberechtigten aus der vertraglichen Bindung lösen, müssen sie den ganzen Vertrag kündigen. Das Kind kann dann nicht mehr an der Bildungsveranstaltung teilnehmen. Gegebenenfalls bleiben jedoch die zeitlich unbegrenzt eingeräumten Nutzungsrechte an den schon vorhandenen Aufnahmen bestehen. Das ist im Einzelfall zu prüfen.
Das Wohl des Kindes
Eines lässt sich aber eindeutig aus der bestehenden Rechtslage ableiten: Die eingeräumten Rechte dürfen nur zum Wohl des Kindes genutzt werden. Insofern sind die Ausführungen der italienischen Datenschutzbehörde durchaus auf die Rechtslage in Deutschland zu übertragen. Denn aus § 1626 BGB ist eindeutig die Verpflichtung der Eltern abzuleiten, für das Wohl des Kindes Sorge zu tragen. Das hat die Kultureinrichtung, die Fotos oder Videos von einem Kinderprojekt veröffentlichen will, uneingeschränkt zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck gilt es Maßstäbe zu entwickeln. Solche Maßstäbe können sein:
- Die Veröffentlichung auf der eigenen Webseite oder auf der Seite seriöser Partner (z.B. die lokale Zeitung) ist weniger problematisch als die Veröffentlichung in den sozialen Medien.
- Gruppenbildern, auf der die einzelnen Kinder nicht sofort zu identifizieren sind, ist der Vorzug zu geben.
- Fotos oder Videoaufnahmen von einzelnen Kindern oder Kindern in Großaufnahme sollten in den sozialen Medien nicht veröffentlicht werden. Soll das doch geschehen, ist zu den einzelnen Veröffentlichungen die ausdrückliche konkrete Zustimmung der Eltern und der Kinder erforderlich. Einem Link zur Veröffentlichung auf der eigenen Seite ist in jedem Fall der Vorzug zu geben.
- Es empfiehlt sich, auch bei anderweitiger Veröffentlichung von Fotos oder Videoaufnahmen von einzelnen Kindern oder Kindern in Großaufnahme in Zweifelsfällen noch einmal die ausdrückliche Zustimmung zu den einzelnen Veröffentlichungen sowohl der Eltern als auch der betroffenen Kinder einzuholen.
- Jegliche Veröffentlichungen, die Kinder negativ darstellen oder gar diskreditieren können, sind auszuschließen.
- Großzügigere Handhabungen sind gegebenenfalls dann möglich, wenn Kinder semiprofessionell mit einem entsprechenden Beschäftigungsvertrag an Aufführungen etwa des Kinder- und Jugendtheaters teilnehmen. Dies gilt umso mehr, als hier wegen § 85 Abs. 2 DSGVO nach der Rechtsprechung des BGH die in Deutschland geltenden, das Recht am eigenen Bild regelnden Vorschriften des Kunsturhebergesetzes (KUG) Vorrang haben.
Kinder als Zuschauer
Auch hier kann § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG, in dem es um das Recht am eigenen Bild geht, weiterhelfen. Danach dürfen „Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben,“ ohne Einwilligung dieser Personen veröffentlicht werden. Voraussetzung ist, dass es sich um eine Zusammenkunft von Personen handelt, die, wie es das Oberlandesgericht München einmal ausgedrückt hat, den kollektiven Willen haben, etwas gemeinsam zu tun, und diese Zusammenkunft öffentlich stattfindet. Das ist bei zuschauenden Kindern im öffentlichen Raum eindeutig der Fall. Auch bei der Anwendung dieser Vorschrift ist jedoch eine gewisse Zurückhaltung angebracht, wenn es sich bei den Abgebildeten um Kinder handelt. Deshalb sollten die oben aufgestellten Maßstäbe auch hier gelten. Zudem sollte auf die Tatsache, dass die entsprechenden Fotos oder Videos mit dem Ziel der Veröffentlichung gemacht werden, erkennbar hingewiesen werden (z.B. Eintrittskarte, Spielplan im Netz etc.). Dann kann auch mit einer konkludenten Einwilligung nach § 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO bzw. nach § 22 Satz 1 KUG ausgegangen werden, letzteres vor allem, wenn es sich um Veröffentlichungen von Presse oder Rundfunk handelt.
Fazit
Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Verbreitung von Kinderbildern oder -videos im Internet ein äußerst schwieriges Terrain ist. Zu welcher Rechtsgrundlage nach § 6 DSGVO man sich auch immer entscheidet, es bleiben stets ein paar rechtliche Unwägbarkeiten bestehen. Deshalb ist allen Kulturinstitutionen, die Kulturprojekte mit Kindern veranstalten, zu großer Vorsicht zu raten.
Der Bußgeldbescheid der italienischen Datenschutzbehörde mit ausführlicher Begründung ist einzusehen unter: Provvedimento del 10 luglio 2025 [10162731] – Garante Privacy