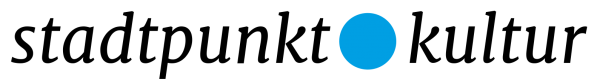Hallervorden hatte den Mut, einen Antrag auf einstweilige Anordnung vor dem Verwaltungsgericht in Berlin zu stellen, um so der Schließung seines Schlosspark Theaters entgegenzutreten. Das ist erfreulich, überließ die Kultur doch bisher den Corona-Gang zum Gericht allen möglichen anderen Einrichtungen und Unternehmen, die sich nicht auf ein so starkes Grundrecht wie das der Kunstfreiheit berufen konnten.
Das Urteil
Da Hallervorden mit seinem Antrag dennoch in erster Instanz gescheitert ist, lohnt ein Blick auf die Begründung des Gerichts. Die zentralen Argumente der Entscheidung (Aktenzeichen VG 14 L 516/20) lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen:
- Der Besuch eines Theaters ist besonders gefährlich, allein wegen des Ausstoßes der Aerosole durch die auftretenden Künstler, aber auch wegen der Kommunikation der Zuschauer untereinander. Ob die Hygiene-Maßnahmen, die die Theaterbetriebe ergriffen haben, dem ausreichend entgegenwirken, ist fraglich, jedenfalls nicht bewiesen.
- Eingegriffen wird durch die Schließung nur in den Wirkbereich (es gibt keine Zuschauer), nicht in den Werkbereich (die Künstler können weiterarbeiten). Man kann proben, Aufführungen nachholen und elektronische Formate nutzen.
- Gerade die Möglichkeit der elektronischen Formate und das damit verbundene Erreichen der Zuschauer lässt den Eingriff in die künstlerische Freiheit gegenüber dem Gesundheitsschutz zurücktreten.
- Die Schließung ist zeitlich befristet.
- Es gibt finanzielle Überbrückungshilfen.
- Das Gleichheitsgebot besonders im Vergleich mit weiterhin erlaubten kirchlichen Veranstaltungen ist nicht verletzt.
- Kultur ist eine, wenn auch hochwertige, Form der Freizeitgestaltung und muss als Freizeitveranstaltung deshalb eher die Beeinträchtigung hinnehmen als andere Bereiche.
Das Urteil ist zwar nur das eines Verwaltungsgerichts, also keine höchstrichterliche Rechtsprechung, verdient aber dennoch wegen seiner ausgiebigen Begründung schon eine gewisse Beachtung.
Die endgültige Fassung von § 28 a Infektionsschutzgesetz
Der neue § 28 a Infektionsschutzgesetz konkretisiert die Maßnahmen, die (ausschließlich zur Bekämpfung von Covid 19 und nicht wegen anderer Pamdemien) ergriffen werden können. Die mit heißer Nadel genähte Entwurfsfassung der Vorschrift hat durch die Beschlussempfehlung des für Gesundheit zuständigen Bundestags-Ausschusses auch für die Kultureinrichtungen und -betriebe eine deutliche Verbesserung erfahren. Insbesondere hat man die Eingriffe in den Kulturbereich von denen in den Freizeitbereich getrennt und ist insoweit schon einmal der Sichtweise des oben zitierten Urteils nicht gefolgt. Außerdem wurde in der Gesetzesbegründung die Bedeutung der Kultur besonders hervorgehoben. Dort heißt es:
„Die Untersagung und Beschränkung des Betriebs von Kultureinrichtungen oder von Kulturveranstaltungen sind insbesondere grundrechtsrelevant mit Blick auf die Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, der die künstlerische Betätigung selbst („Werkbereich“), aber auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks („Wirkbereich“) umfasst und damit auf Seiten der Veranstalter wie auch der Künstlerinnen und Künstler selbst wirksam wird. Bei Untersagungen oder Beschränkungen im Bereich der Kultur muss der Bedeutung der Kunstfreiheit ausreichend Rechnung getragen werden. Beschränkungen insbesondere des Wirkbereichs können in einer volatilen Pandemielage mit dem Ziel einer Reduzierung von Infektionszahlen erforderlich sein, um den Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit angemessen gewährleisten zu können.“
Mit diesem Hinweis beschreibt man die sich aus der Kunstfreiheit ergebenden grundgesetzliche Rechtslage und unterscheidet auch – wie das Verwaltungsgericht Berlin – in den Werk- und den Wirkbereich. Ebenso wichtig sind aber einige Aspekte, die für alle Maßnahmen nach § 28 a Infektionsschutzgesetz gelten und sich aus den Absätzen 3, 5 und 6 ergeben. Dazu gehören.
- Regionale Unterschiede der Maßnahmen je nach Infektionsgeschehen,
- Begrenzung der Maßnahmen auf grundsätzlich vier Wochen (allerdings mit Verlängerungsoption),
- Begründungszwang für alle Maßnahmen,
- Einbeziehung von „sozialen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit“ in die Entscheidungsfindung,
- Herausnahme von sozialen, gesellschaftlichen und oder wirtschaftlichen Bereichen, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung sind, soweit ihre Einbeziehung zur Verhinderung der Verbreitung von Covid 19 „nicht zwingend erforderlich ist“.
Die Bewertung
Mit Rücksicht auf das zitierte Urteil und die neue Gesetzeslage sind die Eingriffe in den Kulturbereich schwieriger geworden. Dies gilt vor allem angesichts des hohen Niveaus der Hygieneschutzmaßnahmen von Theatern, Konzertsälen und Museen. Die Unterscheidung in den Wirk- und den Werkbereich verkennt bei den Theatern und Konzertsälen, dass das Spielen vor Publikum ein wesentlicher Teil des Werkbereichs ist. Der Schauspieler, jede darstellende Künstlerin in einem Theater übt bei jeder Vorstellung eine künstlerische Tätigkeit aus, auch wenn jedes Mal dasselbe Stück gespielt wird. Das wird vor allem bei dem Hinweis des Verwaltungsgerichts Berlin auf die Möglichkeit der digitalen Vermittlung außer Acht gelassen.
Sowohl aus dem Gesetz als aus dem Urteil ergibt sich jedoch eindeutig, dass an Eingriffe in den Werkbereich besonders hohe Anforderungen zu stellen sind. Das macht deutlich, dass z.B. die Untersagung des Probenbetriebs, der im ersten Lockdown stattgefunden hat, nur unter extremen Bedingungen möglich ist, die im Frühjahr dieses Jahres keinesfalls vorgelegen haben und zur Zeit auch nicht vorliegen. Eine ganz andere Frage ist, ob und wann sich die Theater und Orchester selbst entscheiden, eine Zeit lang zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht zu proben.
Jede Verlängerung einer Schließung stellt nunmehr ebenfalls höhere Anforderungen an den Eingriff in das Grundrecht der Kunstfreiheit. Dies gilt umso mehr angesichts des nun gesetzlich geforderten Begründungszwangs. Der einfache Mechanismus der Fortsetzung der Maßnahmen bei Fortbestand der hohen Infektionszahlen ist – auch als politische Forderung (z.B. Söder, Scholz) formuliert – mit der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr vereinbar. Hinzu kommt, dass je niedriger die Zahlen sind, desto abstrakter ist die Gefahr und desto schwieriger ist der Eingriff in einen Betrieb. Die Tatsache, dass dabei nicht nur auf wirtschaftliche, sondern vorrangig auf soziale und gesellschaftliche Aspekte abgestellt wird, mach deutlich, dass gerade bei Eingriffen in die Kulturbetriebe besondere Hürden zu überwinden sind.
Nicht auf die gleiche Stufe gestellt sind die Kultureinrichtungen jedoch mit den religiösen Versammlungen, die in § 28 a Abs. 2 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz eine besondere Privilegierung erfahren. Denn bei religiösen Zusammenkünften wie einer Messe sind auch die Besucher durch die in Artikel 4 Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit geschützt. Einen solchen Schutz können die Besucher einer Kulturveranstaltung nicht für sich in Anspruch nehmen. Ob sich diese Trennung sauber durchhalten lässt, ist allerdings spätestens bei einer Konzertsaal-Aufführung etwa von Mozarts „Requiem“ in Frage gestellt. Jedenfalls können sich die Zuschauer jedoch auf Artikel 2 Grundgesetz berufen, da die Schließung einer Kultureinrichtung sie an der freien Entfaltung der Persönlichkeit hindert. Das folgt vor allem aus der Tatsache, dass die Kultur richtigerweise gesetzlich nicht mehr dem Freizeitbereich zugeordnet wird. „Kulturorte sind Orte der Sinnsuche und der Erkenntnis und deswegen gerade in Zeiten wie diesen wichtig für unsere freie, offene und demokratische Gesellschaft. Theater und Orchester sind Kristallisationspunkte für unsere gesellschaftlichen Diskurse.“, hat Carsten Brosda, der Hamburger Kultursenator, nach seiner Wahl zum Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gesagt. Und das ist eben mehr als Freizeitgestaltung.
Resümee
Insgesamt darf dennoch die hohe Gefährdung der Bevölkerung durch das Corona-Virus nicht verkannt werden. Das gilt erst recht, wenn man bedenkt, wie hoch möglicherweise die Dunkelziffer nicht erfasster Erkrankungen ist. Der gerade in Südtirol durchgeführte Flächentest hat eine Infektionszahl von 1.1 Prozent der Getesteten zu Tage gefördert. Das ist eine ganze Menge, prozentual deutlich mehr als die Zahlen, die zurzeit täglich für die Bundesrepublik Deutschland gemeldet werden. Politik und Gesellschaft entbindet das aber nicht von der Pflicht, ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Gesundheitsschutz einerseits und dem Schutz von Grundrechten andererseits herzustellen. Diese Verpflichtung ist durch die Einführung des § 28 a in das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Fassung deutlicher geworden. Mit populistischen Sprüchen in die eine oder andere Richtung wird man ihr jedoch nicht gerecht. Nur mit finanzieller Entschädigung allerdings auch nicht. Denn es geht bei der künstlerischen Arbeit um mehr als den reinen Broterwerb.