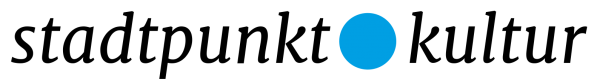16. Juni 1990. Hauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins in Duisburg. August Everding, der wortgewaltige damalige Generalintendant der Bayerischen Staatstheater und Präsident des Bühnenvereins tut das, was er am liebsten tut: Eine Rede halten. Darin hieß es:
„Wer beginnt in diesen Tagen seine Rede nicht mit dem Hinweis auf die großen Zeiten, in denen wir gerade leben. Auch der Deutsche Bühnenverein ist am Geschehen nicht vorbeigegangen. Wir haben mit den Kollegen der DDR in Berlin diskutiert. Viele Landesverbände haben Solidaritätsaktivitäten gestartet und viele einzelne Theater haben im Austausch mit den Kollegen kooperiert. In der DDR ist der Bühnenbund gegründet worden… Dann wird sich bald die Frage stellen, ob es nicht nur einen Verein geben soll. Meine Damen und Herren, diese Frage haben nicht wir zuerst gestellt, aber wir müssen uns auf eine Antwort vorbereiten. Die DDR hat 16 Millionen Einwohner, 69 Theater, darunter Kinder- und Puppentheater…. Wir (die alte Bundesrepublik, der Verf.) haben 63 Millionen Einwohner (und) 150 Theater…. Der Vergleich ist nicht ganz statthaft, aber doch interessant… Es kommen schwere Zeiten auf unsere Kollegen zu…“
Everding war in dieser Hauptversammlung nicht der einzige Redner. Auch Gabriele Muschter, von Mai bis Oktober 1990 Staatssekretärin im Kulturministerium der DDR, kam zu Wort. Sie spricht „über die Sorgen und Nöte, die fast alle Theater in der DDR jetzt haben,“ und führt weiter aus: „Gründe, Theater zu schließen, sehen wir nicht, denn gerade sie waren durch die Geschichte hindurch geistige Zentren im Leben der Kommunen. Im Gegenteil, ich denke, es ist zu überlegen, ob es nicht auch wichtig ist, die eigenartigen kulturellen Strukturen, die mit einem Stück leidvoller DDR-Geschichte zu tun haben, in den Einigungsprozess einzubringen.“ Und doch geht es in ihrer Ansprache dann um „Verwaltungsapparat verkleinern“, „personelle Veränderungen“, darum, dass sich „Ensembles freimachen müssen von unnötigem Verwaltungsballast und unfähigen Leitungen“, und dass „Künstler künftig über andere Wege und Formen zu ihrer Arbeit kommen müssen.“
Das beschrieb ohne Umschweife die Ausgangslage für das Zusammenwachsen der deutschen Theaterlandschaft. Dennoch sprach man im Juni 1990 nur von einer Zusammenarbeit zwischen dem Bühnenbund, der unmittelbar nach 1989 auf dem Territorium der früheren DDR gegründet worden war, und dem schon bereits nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland wieder ins Leben gerufenen Deutschen Bühnenverein. Von Vereinigung beider Organisationen war zunächst nicht die Rede. Schließlich war es aber dann am 21. Oktober 1990 doch soweit: Bühnenverein und Bühnenbund taten sich zum Deutschen Bühnenverein zusammen und machten die Gestaltung der zukünftigen Theaterlandschaft in Deutschland zu ihrer gemeinsamen Aufgabe. Und der Orchesterlandschaft! Denn der Deutsche Bühnenverein war schon immer auch der Verband der Orchesterunternehmen, dem bis heute an die 100 große Klangkörper angehören.
Aufbruch und Reformerwartungen
Was das für die Theater in der früheren DDR hieß, hatte Arnold Petersen, damals Intendant des Nationaltheaters Mannheim, in einem Interview mit „Theater heute“ bereits im September 1990 formuliert. Zwar sprach er von einem Neuaufbau, von neuen Strukturen und warnte davor, dass die dortigen Theater, damit meinte er die in der DDR, „jetzt einfach so an die westdeutschen Verhältnisse anknüpfen.“ Es gebe ja nicht einmal Rechtsträger, also Länder und Gemeinden, die sich für die Theater und Orchester verantwortlich fühlten. In Stralsund und Weimar habe man ihm erzählt, spätestens im November seien die dortigen Theaterbetriebe pleite. Und dann stellte er die Frage, ob man den bisher in der DDR für die Mitarbeiter der Theater geltenden Rahmenkollektivvertrag nicht zumindest insoweit auf die Theater und Orchester in den alten Bundesländern übertragen könne, als in Zukunft für alle Theatermitarbeiter ein einheitlicher Tarifvertrag gelten solle. Er spielte damit auf die Kritik der Theaterintendanten im Westen an, sieben unterschiedliche Tarifverträge in einem Drei-Sparten-Theater anwenden zu müssen. Fraglich erschien ihm an einem solchen dem Rahmenkollektivvertrag entsprechenden einheitlichen Tarifvertrag nur, dass auch die künstlerischen Mitarbeiter der Theater in der früheren DDR unbefristete Arbeitsverträge hatten, was jeden aus künstlerischen Gründen notwendigen Austausch des künstlerischen Personals letztlich nicht zuließ.
Auch die Dramaturgische Gesellschaft äußerte sich im Februar 1991 zur deutschen Theatersituation. Sie sprach von „Angst und Verunsicherung“, die sich in den Theatern der früheren DDR breitmachten. „Kleinmütigkeit, Buchhalterei und Defensiv-Verhalten müssen abgebaut werden. Die gegenwärtige Debatte ist gekennzeichnet durch Schließungs-Fantasien,“ hieß es in ihrer Stellungnahme. Und auch hier wurden Reformillusionen geschürt, indem man feststellte: „Die derzeitige Umbruchsituation ist die einmalige Chance, die Organisation der Theaterarbeit umzustrukturieren, das Tarifsystem des westdeutschen Theaters nicht nur nach Plan zu übertragen, sondern die Kombination der progressiven Elemente beider Arbeitssysteme zu wagen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen, das den besonderen Bedingungen der Produktion und Präsentation von Theater Rechnung trägt.“
Die Rolle der Übergangsfinanzierung des Bundes
Die finanziellen Probleme, vor denen sowohl Petersen als auch Muschter warnten, wurden aufgefangen durch die ab 1991 gewährte Übergangsfinanzierung des Bundes für die Kultur in den dann entstehenden neuen Ländern. Mit 900 Millionen DM im Jahr startete man in diese Übergangsfinanzierung, um sie dann im Laufe der nachfolgenden Jahre langsam zu reduzieren und schließlich auslaufen zu lassen. Da die Theater und Orchester zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil von dieser Übergangsfinanzierung profitierten, hatte diese praktisch zur Folge, dass viele der Strukturen in den neuen Ländern erhalten bleiben konnten. Ja, zuweilen sahen sich einzelne Rechtsträger in den neuen Ländern dazu berufen, diese Strukturen noch zu verfestigen, etwa dadurch, dass manchem Orchester eine relativ hohe Vergütung zugesagt wurde. Warnungen, das werde man sich in Zukunft, spätestens nach Auslaufen der Übergangsfinanzierung des Bundes, nicht leisten können, wurden gerne in den Wind geschlagen.
So merkwürdig es klingt: Die Übergangsfinanzierung des Bundes für die Kultur in den Neuen Ländern hat also nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass sämtliche oben dargestellten Erwartungen, die Vereinigung der deutschen Theater-und Orchesterlandschaft zu einer Systemreform zu nutzen, zunächst unerfüllt blieben. Zwar mag dies auch daran gelegen haben, das bis heute niemand in der Lage ist, zum Ensemble-und Repertoirebetrieb, wie er sowohl in der alten Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR bereits das typische Stadttheater auszeichnete, eine ernsthafte Alternative zu entwickeln, zumindest keine ernsthafte Alternative, die sowohl den künstlerischen Ansprüchen der Theater und Orchester einerseits als auch den Bedürfnissen nach sozialer Absicherung von Mitarbeitern andererseits in ausreichendem Maße gerecht wird. Schon deshalb entwickelte seinerzeit die Bereitschaft, die juristischen Rahmenbedingungen, die für die Theater und Orchester in der alten Bundesrepublik Deutschland galten, auf die neuen Länder zu übertragen, eine zunehmende Dynamik. Entscheidend aber war: Die Übergangsfinanzierung des Bundes erlaubte es, diese juristischen Rahmenbedingungen zu finanzieren.
Zudem nahm nach der dann tatsächlich vollzogenen Wiedervereinigung und der Übertragung des westlichen Rechtssystems auf die neuen Länder die Erwartung zu, auch spezifische tarifliche Regelungen, die auf der Grundlage dieses Rechtssystems entstanden waren, in die dortigen Theater und Orchester zu übernehmen. Und es kam zu einem regen Austausch von künstlerischen Beschäftigten zwischen Ost und West bzw. West und Ost, was zur Folge hatte, dass sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite die Notwendigkeit gesehen wurde, zu gleichlautenden tariflichen Regelungen in der ganzen Bundesrepublik Deutschland zu gelangen.
Die Übernahme der Theater-Tarifverträge in die neuen Länder
Bereits im Laufe des Jahres 1990 begannen also die Verhandlungen zwischen dem Bühnenverein und der Musikergewerkschaft, der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) mit dem Ziel, den Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (TVK) auf die Theater – und Orchesterbetriebe der neuen Bundesländer zu übertragen. Parallel dazu fanden Verhandlungen zwischen Bühnenverein und Künstlergewerkschaften statt, nämlich der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) und der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer (VdO). Diese Verhandlungen bezogen sich auf die tariflichen Regelungen des künstlerischen Personals. Schon wenige Monate später, also bereits 1991, wurde eine Einigung erzielt, der entsprechend sämtliche tariflichen Theater- und Orchester-Regelungen – mit Ausnahme der Vergütungen, die erst im Laufe der Jahre eine Angleichung erfuhren – auf das damals sogenannte Beitrittsgebiet übertragen wurden. Für die Theater war dies insoweit von großem Vorteil, als die für das künstlerische Personal geltenden tariflichen Regelungen im Sinne der künstlerischen Freiheit außerordentlich flexibel sind. Keine feste Arbeitszeitregelung sowie in weiten Teilen ein befristeter Arbeitsvertrag als Regelvertrag und für Solisten nur eine Mindestgage, also kein Gagengefüge, sind hier als wesentliche Regelungs-Materie zu nennen.
In den Verhandlungen gab es dennoch zwei Aspekte, die deutlich werden lassen, wie zwiespältig diese Übertragung durchaus war.
In dem für die Musiker geltenden TVK existierte schon damals ein § 51, heute § 53 TVK. Diese Vorschrift enthält einen kostenintensiven Sozialplan für den Fall der Verkleinerung oder Auflösung eines Orchesters. Umstritten war es, inwieweit diese Vorschrift auch für die Orchester in den neuen Ländern gelten sollte. Denn schließlich wussten alle, dass die vereinigte Republik von der DDR umfangreiche Orchesterstrukturen geerbt hatte, die, wie oben bereits erwähnt, durch die Übergangsfinanzierung des Bundes teilweise auch noch arbeitnehmerfreundlich aufgebessert worden waren. Zwar konnte man sich schließlich darauf verständigen, dass besagter § 51 TVK in einer Übergangszeit nicht für die Orchester in den neuen Ländern gelten sollte. Jedoch gelang es in dieser Übergangszeit nicht, die Orchesterstrukturen derartig zurückzuführen, dass sie sich heute auf einem problemlos finanzierbaren Niveau befänden. Bemerkenswert aber war, dass sich damals auf Arbeitgeberseite die Haltung breit machte, man möge doch § 51 TVK ruhig für die Orchester der neuen Bundesländer gelten lassen, weil die Sozialplanregelung der genannten Vorschrift den Rechtsträgern ihre Neigung, Orchester zu verkleinern oder gar aufzulösen, zu teuer werden lasse. So diene die Sozialplanregelung praktisch dem Erhalt der Orchester in den neuen Ländern, eine Rechnung, die bis zum gewissen Grad durchaus aufgegangen ist.
Ähnlich verhielt es sich mit der so genannten 15-Jahre-Regelung in den für das künstlerische Personal der Theater geltenden und auf die neuen Länder übertragenen Künstlertarifverträgen. Diese Regelung legt fest, dass nach einer 15 Jahre andauernden Beschäftigung der bestehende Arbeitsvertrag nichts mehr beendet werden kann, enthält also einen Beendigungsschutz (der im Übrigen heute unter bestimmten Voraussetzungen erst nach 19 Jahren greift). Nach einer Beschäftigung von dieser Dauer kann also nur noch eine inhaltliche Veränderung des Arbeitsvertrages – sei es hinsichtlich der Tätigkeit, sei es hinsichtlich der Vergütung – arbeitgeberseits herbeigeführt werden. Für die im künstlerischen Bereich der Theater beschäftigten Mitarbeiter bedeutete eine Übertragung der Vorschrift auf die Theater der neuen Länder, dass alle Schauspieler, Sänger, Tänzer und andere Bühnenkünstler, die in einem DDR-Theater bereits 15 Jahre beschäftigt waren, nicht mehr entlassen werden konnten. Gerade mit Rücksicht auf eine durchaus überhöhte Besetzung der Ensembles der DDR-Theater war dies außerordentlich bedenklich. Interessanterweise sprachen sich aber auch hier viele Arbeitgeber aus den betroffenen Theatern für eine solche Übertragung aus, weil sie der Auffassung waren, ein Theater könne nicht mehr geschlossen werden, wenn es über eine hohe Anzahl von nicht mehr aufzulösende Arbeitsverträgen mit künstlerischen Mitarbeitern verfüge. Und so kam es dann zu der Übertragung der so genannten 15-Jahre-Regelung auf die Theater der neuen Länder, was natürlich später die Betriebe ebenfalls vor erhebliche Finanzierungschwierigkeiten stellen sollte.
Die Finanzierungsschwierigkeiten nehmen zu – der Haustarifvertrag mit Gehaltsverzicht
Wie konnte man diese Finanzierungsschwierigkeiten nun bewältigen? Sehr schnell stellte sich heraus, dass zu den gegebenen tariflichen Regelungen viele, vor allem kleinere Theater oder Orchester in den neuen Ländern nicht zu betreiben waren. Die Sorge, aus der angespannten finanziellen Situation könnte sich doch die Schließung einzelner Einrichtungen ergeben, nahm erheblich zu, als der Berliner Senat 1993 das Schillertheater und mit ihm das Schlossparktheater im Westteil der Stadt schloss. Sie ließ bei den Gewerkschaften die Bereitschaft entstehen, für Theater und Orchester in den neuen Ländern haustarifvertraglich teilweise erhebliche Kürzungen der Vergütungen zu vereinbaren, um im Gegenzug betriebsbedingte Beendigungen von Arbeitsverhältnissen in diesen Haustarifverträgen auszuschließen. Am Anfang war man der Überzeugung, diese Haustarifverträge seien ein vorübergehender Zustand für einzelne Betriebe. Man nahm an, während der Laufzeit des Haustarifvertrages werde im jeweiligen Betrieb durch sogenannte natürliche Fluktuation (Ruhestand, Wechsel an ein anderes Theater) das Personal sozialverträglich abgebaut, so dass nach Auslaufen des Haustarifvertrags an alle wieder die flächentarifvertragliche Vergütung gezahlt werden könnte. Diese Annahme erwies sich aus zwei Gründen als trügerisch. Erstens stellte sich in vielen Fällen heraus, dass nicht jede freiwerdende Stelle unbesetzt bleiben konnte, wollte man den bisherigen Spielbetrieb aufrechterhalten. So kam es zwar zu einem Personalabbau, der aber keineswegs ausreichte, um nach Auslaufen des Haustarifvertrages die notwendige Vergütungsanpassung vorzunehmen. Zweitens hatte man nicht erkannt, dass an manchen Standorten dauerhaft ein Theater oder Orchester nicht zu den bisherigen flächentarifvertraglichen Bedingungen unterhalten werden konnte. Insoweit wurden die Haustarifverträge regelmäßig wieder verlängert, so dass bis heute der größte Teil der Theater- und Orchestermitarbeiter in den neuen Ländern einen Gehaltsverzicht leistet.
Die Fusion und dann doch: Die Reform
Parallel dazu wurden zwei weitere Entwicklungen eingeleitet. Man prüfte zum einen an manchen Standorten, ob es möglich sein könnte, Theater und/oder Orchester miteinander zu fusionieren. Zu solchen Fusionen kam es etwa in Altenburg/Gera, Greifswald/Stralsund, Halberstadt/Quedlinburg, Freiberg/Döbeln oder Plauen/Zwickau. Als dann Ende der neunzehnhundertneunziger Jahre im Freistaat Thüringen die Fusion des Nationaltheaters Weimar mit dem städtischen Theater Erfurt ins Gespräch kam, stellte sich schnell heraus, dass solchen Fusionsüberlegungen aus politischen Gründen Grenzen gesetzt waren. Vor allem das Nationaltheater Weimar konterte diese Überlegungen mit dem so genannten „Weimarer Modell“, das gerade mit Rücksicht auf die eingangs zitierten Reformbestrebungen viel öffentliche Aufmerksamkeit erreichte. Bei genauem Hinsehen entpuppte sich dieses Modell jedoch letztlich als ein Haustarifvertrag mit Gehaltsverzicht. Das hatte für die Theater und Orchester in den neuen Ländern weitreichende Bedeutung, weil damit die Haustarifverträge, die für einzelne Theater und Orchester in den neuen Ländern bisher meist hinter verschlossenen Türen abgeschlossen worden waren, ein hohes Maß an politischer Aufmerksamkeit erfuhren und hoffähig wurden. Auch dies hat dazu beigetragen, dass sich die Praxis, mit Haustarifverträgen die Vergütungen herunterzufahren, in den Theatern und Orchestern der neuen Länder verfestigte.
Die zweite Entwicklung lag in der dann doch eingeleiteten Reform der öffentlich getragenen Theater und Orchester. Sie ist insofern interessant, als mit dieser Reform dann schließlich doch an die oben geschilderten, nach der Wiedervereinigung geäußerten Reformerwartungen zumindest teilweise angeknüpft wurde. Zur Einleitung einer solchen Reform hatte der Bühnenverein Anfang der neunzehnhundertneunziger Jahre einige Papiere vorgelegt, die zusammengefasst zwei Vorschläge enthielten: Entbürokratisierung und Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Während die erste Maßnahme durch die Betriebe selbst herbeigeführt werden musste, etwa durch die Herauslösung von Theatern aus der städtischen oder staatlichen Verwaltung oder auch nur durch die Rationalisierung von – teilweise infolge von personalvertretungs- bzw. betriebsverfassungsrechtlichen Vereinbarungen bestehenden – theater- und orchesterinternen Arbeitsabläufen, erwies sich die zweite Maßnahme als deutlich schwieriger. Trotz einiger vor allem vom Bühnenverein formulierter Vorschläge gesetzlicher Änderungen zeigte sich die Politik in dieser Frage äußerst zurückhaltend.
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen der Theater und Orchester konnten also nur herbeigeführt werden durch eine mehr oder weniger massive Umgestaltung von tariflichen und vergleichbaren Regelungen. Dieser hochkomplizierte Prozess fand dann in der Zeit bis 2009 vor allem mit dem Ziel einer Flexibilisierung von Arbeits-und Produktionsbedingungen statt. So kam es 2002 zum Abschluss eines vollständig neuen Tarifvertrags für das künstlerische Personal, der insgesamt fünf zuvor geltende Tarifverträge zu einem Tarifvertrag, dem Normalvertrag Bühne (NV Bühne), zusammenfasste. Am 31. Oktober 2009 wurde dann ein ebenfalls reformierter Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (TVK) abgeschlossen. Auch die zwischen dem Deutschen Bühnenverein und dem Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage abgeschlossene sogenannte Regelsammlung, in der die Konditionen für die Übertragung von Aufführungsrechten einschließlich der zu zahlenden Urhebervergütung festgelegt sind, wurde durch die Neufassung vom 1. August 2005 wesentlich verändert. Parallel dazu reformierte auch der öffentliche Dienst seine Tarifverträge, was insoweit für die öffentlich getragenen Theater von Bedeutung war, als dass das nichtkünstlerische Personal dieser Betriebe auf der Grundlage der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes beschäftigt wird. Sämtliche Maßnahmen ermöglichten es, im Laufe der gleichen Zeit die Anzahl der Arbeitsplätze in den öffentlich getragenen Theaterbetrieben (einschließlich ihrer Orchester) ganz Deutschlands von seinerzeit 45.000 Mitarbeitern auf heute etwa 39.000 zu reduzieren. Dabei blieb das künstlerische Angebot der genannten Institutionen zwar weitgehend erhalten. In vielen Theatern wurde aber erkennbar, dass die sich aus dem Personalabbau ergebenden Probleme zu veränderten Produktionsweisen führten, etwa durch einen deutlicher dem Stagione angelehnten Spielplan mit stärkerem Projektcharakter. Daraus ergab sich wiederum die Konsequenz, dass die Anzahl der unständig Beschäftigten der Theater und Orchester in der gesamten Bundesrepublik Anfang der neunzehnhundertneunziger Jahre ca. 8000 Verträgen auf heute etwa 25.000 Verträge zunahm.
Zu fragen ist nun, ob diejenigen, die unmittelbar nach der Wiedervereinigung eine Reform der öffentlich getragenen Theater und Orchester im Auge hatten, tatsächlich diese Veränderung wollten. Denn mittlerweile macht sich die Erkenntnis breit, dass das, was Reform sein sollte, tatsächlich nichts anderes war, als eine Verschlechterung von sozialen Bedingungen im Bereich der darstellenden Kunst. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nun Gegenkräfte zu wirken beginnen. Sie liegen nicht nur in einem sich wieder verstärkenden gewerkschaftlichen Engagement, sondern auch in der Gründung verschiedener auf größere Gerechtigkeit bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen der Theater abzielende Initiativen. Ernste Bestrebungen, die Arbeitsbedingungen im Bereich der darstellenden Kunst wieder zu verbessern, sind auch bezogen auf Arbeitgeberseite nicht mehr zu übersehen, bedenkt man alleine, dass zu Beginn der laufenden Spielzeit 2015/16 die für Solisten, also etwa Schauspieler, geltende tarifliche Mindestgage von monatlich 1.650 € auf 1.765 € brutto heraufgesetzt wurde. Und verhandelt wird schon jetzt über eine weitere Steigerung.
Fazit
Am Ende lässt sich feststellen: Die Theater-und Orchesterlandschaft der Bundesrepublik Deutschland, mittlerweile auf der deutschen Liste des immateriellen Kulturerbes, konnte durch die schweren Zeiten finanzieller Zwänge der Wiedervereinigung nicht ernsthaft in Gefahr gebracht werden wenngleich nicht ganz ohne Blessuren, wie etwa auch der Schließung der Mitteldeutschen Landesbühne in Wittenberg oder des Kleisttheaters in Frankfurt/Oder. Veränderungen im Betrieb dieser Kulturinstitutionen sowie Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen trugen und tragen wesentlich dazu bei. Was bis heute in den neuen Ländern fehlt, ist eine parallel dazu sich aufbauende aus Privattheatern und freien Gruppen bestehende Theaterszene. Entscheidend ist jedoch, dass es die Theater und Orchester in Deutschland geschafft haben, sich so weiterzuentwickeln, dass künstlerisch ein vielfältiges Programm gewährleistet ist und dass im künstlerischen Schaffen ein Unterschied zwischen Theatern und Orchestern in West und Ost weitgehend nicht mehr besteht.