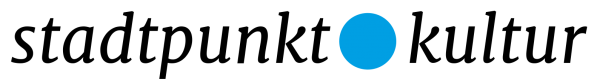Keine eitlen Tweets für die Galerie
Moderiert wurde der Abend von Nicole Deitelhoff und Meron Mendel, die eine Politikwissenschaftlerin, der andere Direktor der Bildungsstätte Anne Frank; beide waren in unterschiedlicher Weise und Funktion auch an der Debatte über die documenta 15 beteiligt. Wie sehr man auseinanderlag in der Beurteilung der Gemengelage, zeigte sich gleich am Anfang. Deitelhoff fragte, ob denn die Präsidentin der TU in Berlin Geraldine Rauch zurücktreten müsse anlässlich ihrer Likes von als antisemitisch zu bewertenden Tweets auf X. Das wurde von Uwe Becker ohne Zögern bejaht. Alena Jabarine hingegen schloss sich zwar der Kritik an dem Verhalten der TU-Präsidentin an, fand aber sogleich mildere Töne, indem sie vor einer Hetzjagd warnte und dafür plädierte, die öffentliche Entschuldigung von Frau Rauch anzunehmen und ihr sowie der Gesellschaft die Chance zu geben, aus einem solchen Fehler zu lernen. Das veranlasste Christoph Möller zu der Anregung, doch nicht immer dem Drang nachzugeben, sich mit Tweets und ähnlichen Aktionen an schwierigen und differenziert zu führenden Debatten zu beteiligen. Nichts zu äußern, sei manchmal der bessere Weg. Mit dieser Feststellung drängte sich das „dröhnende Schweigen“ (Deitelhoff) der deutschen Kulturszene zu dem brutalen Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober geradezu als Thema auf. Möllers regte erneut ein sich Kümmern der Zivilgesellschaft um die Belange der Betroffenen an, statt sich mit eitlen Tweets für die Galerie in Pose zu setzen. Dies gelte umso mehr, ergänzte Alena Jabarine, als Bekenntnisse allein überhaupt nichts änderten.
Kritik an Israel und Antsemitismus
Es folgte eine von Meron Mendel angestoßene Debatte über die Frage, was denn nun genau antisemitisch sei. Die Diskussion darüber changierte zwischen der weitergehenden Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die von einigen als Mittel zur Unterdrückung von Kritik an israelischer Politik infrage gestellt wird, und der Jerusalemer Erklärung, die Antisemitismus konkreter als Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden beschreibt. Es blieb am Ende offen, wie weit die Kritik an der Politik Israels gehen darf, wann das zulässige Maß hin zum Antisemitismus überschritten wird. Letztlich, so wurde in der Runde festgestellt, lasse sich das, was geht und was nicht geht, kaum durch Definitionen erreichen. Christoph Möller nannte die Definitionsversuche sogar „Eingekästel“ und fordert stattdessen einen offen gehaltenen Diskurs, um so wie auch in anderen Bereichen eine Verständigung zu erzielen. Er appelliert schon hier unmissverständlich dafür, dass sich die Politik in bestimmtem Maße aus der intellektuellen und moralischen Ordnungsdebatte heraushalten solle, weil sie sich sonst auf gefährliches Terrain begebe. Zudem sei die Politik damit überfordert. Schon gar nicht solle sie versuchen, bestimmte Standpunkte mit Sanktionen zu belegen. Kulturinstitutionen müssten selbst die Verantwortung übernehmen, vorschreiben könne man ihnen letztlich nichts. Für sie sei es aber auch nicht damit getan, sich in jeder Beziehung einfach auf die Kunstfreiheit zu berufen.
Falsche Prioritäten in der Debatte
Man müsse sich fragen, worauf wir unser Augenmerk richten, so Jabarine. Statt sich über die Berliner TU-Präsidenten zu erregen, sei es wichtiger, dort intensiv hinzuschauen, wo sich Rechtsradikale organisierten. Wachsamkeit gegenüber solchen rechtsradikalen Kreisen in Polizei und Bundeswehr oder angesichts von Nazis in den Parlamenten sei das Gebot der Stunde. Ebenso forderte sie, sich die Lage von palästinensischen Menschen hierzulande bewusst zu machen. Sie würden generell und ohne zu differenzieren kriminalisiert, ja sogar als gefährlich eingestuft, längst trauten sich viele Palästinenser überhaupt nicht mehr, sich öffentlich zu äußern; vielmehr gebe es mittlerweile unter ihnen eine schweigende Mehrheit, die sich abgekoppelt und vom Diskurs zurückgezogen habe.
Zu wenig Empathie
Ob auch da eine gewisse Empathielosigkeit, die der deutschen Gesellschaft von der Diskussionsrunde in Bonn bescheinigt wurde, eine Rolle spielt, blieb offen. Überhaupt waren an dieser Stelle doch eher Zweifel anzubringen, ob es solche Empathielosigkeit tatsächlich gibt. Das hohe Spendenaufkommen, das im Falle von nationalen und internationalen Naturkatastrophen festzustellen ist, zeichnet ein anderes Bild. Die Reaktionen hierzulande auf die Anschläge in Frankreich (Bataclan, Charlie Hebdo) sprechen ebenfalls eine andere Sprache. Zudem ist zu unterscheiden zwischen der oft sicher empfundenen Empathie und der Bereitschaft, sie öffentlich zu äußern. Diese Bereitschaft sinkt, je mehr die öffentliche Äußerung ein politisch nicht gewünschtes oder zumindest kritisch wahrgenommenes System stützt. Im Fall Israel gibt es in der schweigenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung viele, die gerade jetzt Netanjahu nicht in die Hände spielen wollen, dennoch den Anschlag der Hamas am 7. Oktober als grauenerregend empfinden und sich für die israelischen Familien nichts mehr wünschen, als dass die Geiseln so schnell wie möglich freigelassen werden.
Was tun?
Am Ende brachte Nicole Deitelhoff die Diskussion mit der Frage auf den entscheidenden Punkt, ob man denn dem unzweifelhaft vorhandenen Antisemitismus im Kunstbetrieb nicht doch durch eine Antidiskriminierungsklausel als Teil der öffentlichen Förderung beikommen könne. Erneut warf Möllers ein, Recht sei nicht die Lösung, vielmehr seien moralische Abrüstung und Konsenssuche der einzige gangbare Weg. Er warnte zudem vor einem „flächendeckenden System der Gesinnungsprüfung“. Dem pflichtete Jabarine bei und warnte ebenfalls vor „Regularien im Kunstbetrieb“. Den Gedanken an solche Regularien bei gleichzeitiger Steigerung der Anzahl von AfD-Wählern empfinde sie als unangenehm und extrem gefährlich. Zudem dienten solche Regularien doch nur der Unterdrückung von Meinungen, am Ende wisse man nicht, was die Gesellschaft denke, wenn alles Fragwürdige aus dem öffentlichen Raum verbannt werde. Die Essenz der Kunst sei zudem Meinungsvielfalt und Provokation. Mittlerweile stehe der deutsche Kultur- und Diskursstandort international infrage. Als Becker dennoch konsequent forderte, Antisemitismus sei auch im Kunstbetrieb konsequent zu unterbinden, sie verletze die Menschenwürde und die Freiheit der Kunst ende genau da, konnte das Möllers so nicht stehen lassen. Dann müsse man Céline aus den Büchereien und Wagner aus den Opernhäusern verbannen, und das gehe ja wohl doch zu weit.
So ist es, dachte man da als Zuschauer. Die Kunst und die Literatur, der Film, sie strotzen doch nur so von Verletzungen der Menschenwürde. Juristisch problematisch wird das erst, wenn von dieser Verletzung eine konkrete identifizierbare Person betroffen ist. Und so ist zu hoffen, dass sich diejenigen, die gerade einer Regulierung des Kunstbetriebs das Wort reden, wie etwa die Berliner Justizsenatorin kürzlich in der Süddeutschen Zeitung, diese hoch qualifizierte und sachliche Debatte im Nachhinein auf der Website der Bundeskunsthalle (https://www.bundeskunsthalle.de/studiobonn/a-mentsh-is-a-mentsh) genau anschauen. Es könnte der Kunst- und der Meinungsfreiheit ebenso dienen wie dem Kampf gegen Antisemitismus.
Siehe auch:
- https://stadtpunkt-kultur.de/2024/01/antidiskriminierungsklausel-und-code-of-conduct-ueber-die-grenzen-der-kunstfreiheit/
- https://stadtpunkt-kultur.de/2024/03/die-antisemitismusdebatte-in-der-kultur-ein-aufruf-zu-mehr-besonnenheit/
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt.