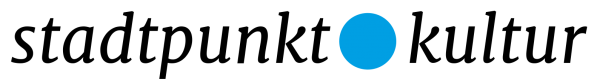Vor allem von Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010 beherrschte das große Sparen Deutschlands öffentliche Haushalte. Man könne späteren Generationen die stetig steigenden Schulden nicht mehr zumuten, hieß es. Heute ist eine völlig marode öffentliche Infrastruktur die Quittung für diese verfehlte Haushaltspolitik. Unter ihr haben auch viele öffentliche Theatergebäude mit einem massiven Renovierungsbedarf zu leiden. Aber darum soll es hier nicht gehen.
Lohnerhöhungen als ungedeckter Scheck
Gehen soll es – zwecks näherer Erläuterung der strukturellen Unterfinanzierung – um die zweifelhafte Weise, mit der mancher Rechtsträger die Theater- und Orchesterförderung damals zusammenstrich. Nicht nur das Hineinkürzen in den laufenden Haushalt war an der Tagesordnung. Weit verbreitet war es, mit den Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst oft nicht unerhebliche Lohnsteigerungen zu vereinbaren. Diese standen dann kraft tarifvertraglicher Vereinbarung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadttheater, Staatstheater und Landesbühnen ebenso zu. Warum sollten die Beschäftigten des Kulturamts auch mehr Geld bekommen, die Schauspielerin oder der Inspizient nicht? Doch dafür die notwendigen öffentlichen Mittel bereitzustellen, dazu war manche Gemeinde zwar beim Einwohnermeldeamt bereit, jedoch nicht bei den Theatern und Orchestern. Für die war die Lohnerhöhung so etwas wie ein ungedeckter Scheck, den sie zu zahlen hatten. Viele dieser Betriebe, vor allem in den neuen Bundesländern, wussten sich zur Vermeidung von Defiziten nur noch mit Personalabbau und Gehaltsverzicht der Mitarbeiterinnen zu helfen. So wurde etwa Künstlern, die jeden Tag auf der Bühne standen, bei einem Jahreseinkommen von gerade einmal 20.000 Euro kurzerhand das 13. Monatsgehalt gestrichen, um das Überleben eines Theaters zu sichern, für die Gewerkschaften wie für den auf Arbeitgeberseite agierenden Deutschen Bühnenverein in vielerlei Hinsicht mehr als eine bittere Pille. Denn die immer geringer werdende Anzahl von Mitarbeitern führte zusätzlich noch zu einer enormen Arbeitsverdichtung ebenso wie das höhere Einnahmesoll, das meist nur mit einem Mehr an Produktionen zu erwirtschaften war. Ein schlechtes Gewissen hatte dabei auf Seiten der Theater- und Orchesterträger damals offenkundig kaum jemand.
Mehr Work-Life-Balance
Kein Wunder also, dass die Debatte über die Work-Life-Balance die Theater irgendwann erreichen würde. So kam es dann schließlich vor einigen Jahren. Mittlerweile hat es im einschlägigen Tarifvertrag, der Normalvertrag (NV) Bühne einige wesentliche Verbesserungen für die Arbeitsnehmerseite gegeben, von mehr und besser planbarer Freizeit über einen Nichtverlängerungsschutz für Schwangere bis hin zu einer kräftigen Erhöhung der Mindestgage. Sie betrug 2016 noch 1850.- Euro. Gerade ist sie auf einen Betrag von über 3.000 Euro angestiegen. Alles das kostet Geld und reduziert die Einsatzmöglichkeiten des Personals und damit die Einnahmemöglichkeiten.
Solche Verbesserungen stoßen natürlich in unseren woken Zeiten auf große Akzeptanz, auch in der Politik. Finanziert werden sie deshalb von dort nicht unbedingt. Das kann in den nächsten Monaten noch bitter werden. Denn allenthalben wird plötzlich sogar wieder von der Kürzung der öffentlichen Kulturförderung gesprochen. Doch viele Theater und Orchester haben die Corona-Einbrüche des Publikums, anders als erwartet oder zumindest erhofft, noch nicht vollständig überwunden. Ob und wie das gänzlich gelingen wird, steht mancherorts noch ein wenig in den Sternen. Gerade im Schauspiel ist in vielen Betrieben die Suche nach den Formen und Inhalten, mit denen das Publikum erreicht werden kann, keinesfalls abgeschlossen. Das gilt erst recht dort, wo nun noch ein Intendantenwechsel stattfindet, zumal der ohnehin stets mit besonderen Kosten verbunden ist (zahlreiche, zum Teil hohe Abfindungen nach NV Bühne bei Nichtverlängerungsmitteilungen wegen Intendantenwechsel, Vorbereitungsetat der neuen Intendanz, Kosten für die Beendigung der bisherigen Intendanz). Künstlerische Neuprofilierungen, denen ein Intendantenwechsel ja dient, sind zudem in der Regel keine Zeiten der explodierenden Einnahmesteigerung. Hinzu kommen (und kamen gerade in jüngster Vergangenheit) die emporschnellenden und sehr volatilen Energiekosten. Theater sind energieträchtige Betriebe, auch wenn noch so sehr das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Spielplan steht. Das alles lässt sich nicht vorauskalkulieren, erst recht nicht in diesen doch schwierigen Zeiten.
Die Finanzierung in der Zukunft
Werden diese zuweilen nicht in allen Details vorauszusehenden Entwicklungen nicht durch die notwendigen öffentlichen Mittel aufgefangen, kann man nur das tun, was oben für die Zeit vor und nach der Jahrtausendwendeschon stattgefunden hat: Es wird wieder an der Personalschraube zu drehen sein. Das kostet Zeit, geht also nicht von heute auf morgen. Kündigungs- und Nichtverlängerungsfristen sind zu beachten, Gagen müssen neu verhandelt werden, Tarifverträge mit Vergütungskürzungen fallen nicht vom Himmel. Und es bündelt Energien, die dann an anderer Stelle fehlen. Wegen des Zeitfaktors konstatieren die Stauten vieler Theater im Übrigen, dass Defizite in einem Haushaltsjahr angesichts der vielen Geschilderten Imponderabilien sehr wohl eintreten können. Man ist ja auf Trägerseite nicht betriebsblind. Diese sind dann aber in den Folgespielzeiten aufzufangen, es sei denn, es gibt Rückstellungen, die das Problem ganz oder zumindest teilweise lösen. Man sorgt ja vor. Aber es ist so wie in der privaten Haushaltskasse. Deren Rücklagen reichen manchmal ebenfalls nicht, wenn plötzlich gleichzeitig die Waschmaschine sowie der Geschirrspüler ausfällt. Auch da geht – Geld hin, Geld her – kein Weg an einer Neuanschaffung vorbei, will niemand der Familie das Leben schwerer machen als es ohnehin schon ist. Die Mittel dafür müssen dann eben später wieder erwirtschaftet werden. So ist es das auch in den Theatern. Schon deshalb sind Kürzungen der öffentlichen Kulturmittel nun wirklich nicht das Gebot der Stunde, erst recht nicht angesichts des drohenden Fachkräftemangels, der gerade die Theater erreicht.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt.