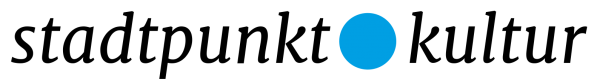Die urbane Zukunft
Ein Anlass für die Gründung des Büros stadtpunkt.kultur im Jahr 2017 war der von der Unesco veröffentlichte Weltbericht, dessen Titel schon Programm ist: „Kultur: urbane Zukunft“. Dies steht im krassen Widerspruch zu der Leerstelle, die der hiesige Kommunalwahlkampf 2025 in der Kulturpolitik aufweist. Zwar enthalten die Wahlprogramme der Parteien in den einzelnen Städten die Rubrik „Kultur“. Was aber die großen und kleinen Kultureinrichtungen der Stadt in der Regel für den Zusammenhalt der Bürgerschaft leisten, wird kaum ersichtlich. Wenn es überhaupt etwas gibt, was die kommunale Diskussion anheizt, dann sind es die Kosten für den Neubau oder die Sanierung von städtischen Kulturgebäuden. Auch da fehlt es jedoch nicht an kuriosen Standpunkten. So fordert die SPD in Köln in ihrem Wahlprogramm (S. 64) allen Ernstes einen sofortigen Baustopp der Oper, und das 13 Jahre nach Baubeginn und 800 Millionen Euro Sanierungskosten. In der Tat ist das eine hohe Summe, die aber vor allem auch dadurch entstand, dass der Sanierungsstau in den städtischen Kulturgebäuden genauso hoch ist wie bei den Brücken und Straßen in NRW. Da können sich die Kulturpolitiker der Domstadt hinsichtlich ihrer früheren Versäumnisse gerne mal an die eigene Nase fassen. Und wenn im Wahlkampf die grüne OB-Kandidatin mehr Queerness in der Kölner Oper fordert, so als wäre Köln die Hochburg der Heteros, oder der CDU-Kandidat mehr Events auf dem Opernvorplatz, dann fühlen sie sich vielleicht auf der Höhe der Zeit, sind es aber eher nicht.
Was Kultureinrichtungen leisten
Am Mittwoch dieser Woche wurde im Bonner Schauspielhaus die „Odyssee“ uraufgeführt, eine Veranstaltung im Rahmen des Bonner Beethovenfestes. Gespielt und deshalb uraufgeführt wurde eine verkürzte neue Textfassung des Regisseurs Simon Solberg, begleitet von einer Neukomposition des in Neu-Dehli geborenen deutschen Komponisten Ketan Bhatti. Die Inszenierung ist mit spektakulären Lichteffekten und viel Nebel, aber einfachen Bühnen-Requisiten eher spektakulär angelegt, was mit einer immer wieder auch aufbrausenden Musik jeglicher Langeweile von vorneherein den Garaus macht. Man mag über die Arbeit denken, was man will, sie leistet jedenfalls zwei wichtige Dinge: Zum einen erzählt sie in einer verständlichen, aber durchaus anspruchsvollen Sprache wesentliche Inhalte der Odyssee. Zum anderen stellt sie das Bild des Helden Odysseus unmissverständlich in Frage. War er vielleicht doch nur „ein Krieger auf Eroberungszug, der mit Gewalt und Lügen seine Macht sichert?“ „Ist in Wahrheit Odysseus´ blutige Rache an den Freiern bei seiner Heimkehr nach Ithaka eigentlich der Amoklauf eines an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidenden Kriegsverbrechers?“ Das sind beides Fragen aus dem Programmheft, die in der Aufführung zur Diskussion gestellt werden. Problematisiert wird ebenso, dass im Originaltext der Odyssee Indigene und Ureinwohner anderer Länder als „Barbaren“ und „Wilde“ bezeichnet werden. Auch das Abwälzen der Verantwortung von eigenen Fehlern auf eine göttliche Macht und das Schicksal kommt unmissverständlich zur Sprache. Wer da nicht merkt, was ein Theater dazu beiträgt, die Weltliteratur lebendig zu halten und gleichzeitig zur aktuellen Weltlage Stellung zu nehmen, muss mit Blindheit geschlagen sein.
Wie interessant wäre es, wenn öfter diese Rolle der städtischen Kultureinrichtungen in einem Kommunalwahlkampf zur Sprache käme. Wenn sich die Parteien deutlicher dazu verhielten, was das alles für das Zusammenleben in der Stadt und den öffentlichen Diskurs bedeutet. Was es bedeutet, dass Menschen aus der Stadt zu Hunderten in einem Gebäude zusammenkommen, um sich mit Literatur, Musik, Kunst, der Welt und ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Dass Kultureinrichtungen zahlreichen Künstlern erlauben, mit ihrer kreativen Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und so Teil einer Stadt sind. Dass Opernhäuser, Orchester und Theater Komponisten veranlassen zu komponieren und Autoren animieren, Stücke zu schreiben. Welchen Beitrag die Kultureinrichtungen leisten zur unverzichtbaren Reflexion, ohne die wir nicht in der Lage sein werden, die Demokratie am Leben zu erhalten und die Probleme dieser Welt zu lösen. Stattdessen: Die Forderung von Etatkürzungen und Strukturveränderungen.
Ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen
Viel wird augenblicklich darüber debattiert, wie wir dem zunehmenden Rechtspopulismus entgegentreten können. Manches Wahlergebnis zeigt, es ist diesbezüglich fünf vor zwölf. Viel Richtiges ist dazu schon geschrieben worden, etwa dass einiges wieder besser funktionieren muss, dass der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust Einhalt zu bieten ist, dass wir die soziale Sicherheit gewährleisten müssen und dass wir die Einwanderung nach Europa integrativ und auf Akzeptanz ausgerichtet organisiert bekommen, statt einer platten Ausgrenzungspolitik hinterherzulaufen. Doch allein mit Pragmatismus, so wichtig er ist, werden wir es nicht schaffen, unser Land und seine Städte auf demokratischem Kurs zu halten. Wir müssen dem Narrativ der Enge und des Rückwärtsgewandten eine andere Erzählung entgegensetzen. Es ist die Erzählung von Weltoffenheit und Aufklärung. Es ist die der Humanität und der Empathie. Es ist die des (Mit-)Denkens und des (Mit-)Fühlens. Es ist die von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, oder Solidarität für diejenigen, denen die egalité als Ergänzung des schönen alten Wortes fraternité nicht ausreicht. Dieses andere Narrativ ist nicht möglich, ohne dass wir das nach vorne verteidigen, was ein solches Weltbild vermittelt: Bildung, Wissenschaft, Forschung, Literatur und Kunst. Wer alles das nicht zum leidenschaftlichen Inhalt seiner Programme und seiner Reden macht, wird mit noch so pragmatisch richtiger Politik den Trend zum Rechtspopulismus kaum brechen.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt.